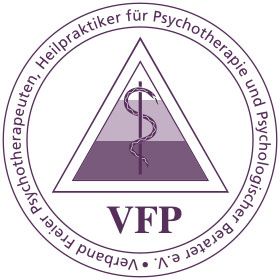Faszination Kunsttherapie
Was ist eigentlich die Kunsttherapie? Die Kunsttherapie ist ein therapeutischer Beruf, in dem mit künstlerischen Mitteln gearbeitet wird. Die unterschiedlichen Fachrichtungen
– Mal- und Gestalttherapie
– Musiktherapie
– Tanz- und Bewegungstherapie
– Sprach- und Dramatherapie
sind Methoden, die den Beruf der Kunsttherapie ausmachen.
Die Kunsttherapie bezieht das Nonverbale in den therapeutischen Prozess mit ein. Allen Methoden ist eigen, dass sie mit wenig Erklärungen auskommen. Es ist das Tun mit dem Medium, das eine persönliche, direkte Erfahrung ermöglicht und so zu einer unmittelbaren Einsicht führt. Die Erkenntnisse, die selbst erarbeitet werden, sind der Boden für neue, bewusste Handlungsweisen.
Die Geschichte der Kunsttherapie
Die Kunsttherapie ist ein gewachsener Beruf. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts haben verschiedene Kliniken in der Schweiz und im Ausland kunsttherapeutische Methoden als Behandlungsmethode angewendet.
Die österreichisch-US-amerikanische Malerin Edith Kramer war Pionierin der Kunsttherapie in den USA. In den 1940er-Jahren widmete sie sich in ihrer kunsttherapeutischen Arbeit vor allem Kindern aus problematischen gesellschaftlichen Milieus.
Im Jahr 1922 veröffentlichte der Heidelberger Psychiater Hans Prinzhorn sein Buch „Die Bildnerei der Geisteskranken“, indem er sich vor allem mit der Psychologie und der Psychopathologie der Gestaltung auseinandersetzte. Für ihn bedeuteten die bildnerischen Arbeiten einen wichtigen Zugang zur Psyche seiner Patienten. Prinzhorn trug in der Zeit von 1919 bis 1921 rund 5 000 Bilder, Zeich
nungen, Collagen, Skulpturen und andere Projekte psychisch kranker Patienten zusammen und zeigte seine Sammlung erstmals 1922 der Öffentlichkeit.
Der Einfluss dieser Bilder auf die führenden Künstler dieser Zeit war groß. Für Paul Klee, Max Ernst, André Breton, Alfred Kubin und Jean Dubuffet wurde durch die Sammlung Prinzhorns ein Prozess der unmittelbaren Kreativität ermöglicht. Sie waren Vorbild für ihr eigenes künstlerisches Schaffen.
In C. G. Jungs Psychotherapie spielte die zeichnerische Gestaltung von Anfang an eine große Rolle. Jung forderte z. B. den Patienten auf, einen Traum oder eine Serie von Träumen zu zeichnen.
In Träumen kommt nach Jung individuales unbewusstes Material zum Ausdruck. Später sind auch auf privater Ebene immer mehr kunsttherapeutische Malateliers, Praxen und Ausbildungsgänge entstanden, die einen wesentlichen therapeutischen Auftrag erfüllten. Nun wird diese Pionierarbeit von einer neuen Phase abgelöst, in der Qualitätssicherung und Anerkennung eine Rolle spielen. Es ist, als ob die Kunsttherapie lange Jahre als Unkraut gewuchert hätte und sich nun als Heilkraut herausstellt.
Kunsttherapie ist ein Beruf der Zukunft
Die Kunsttherapie ist ein vielfältiger Beruf. Nicht nur sind es die vier unterschiedlichen Fachrichtungen, die die Vielseitigkeit des Berufes bestimmen, es sind auch die unterschiedlichen Methoden innerhalb der Fachrichtungen, die den unterschiedlichsten Menschen gerecht werden.
Gerade die Vielfalt des Berufs ist allen Verbänden ein großes Anliegen. Kunsttherapie jeder Fachrichtung und Methoden kann bei den verschiedenen Anliegen Anwendung finden.
In den Beiträgen werden Behandlungen von körperlichen und psychischen, oft auch psychosomatischen Beschwerden beschrieben. Die Verbände kümmern sich um eine persönliche Weiterentwicklung und Zufriedenheit.
Alle Methoden können mit wenigen verbalen Erklärungen auskommen. So ist es auch möglich, frühkindliche Erlebnisse, undefinierbare Gefühle und Panik zum Thema und zur Auseinandersetzung zu bringen.
Während in den Schulen Kunst und Kultur immer mehr als „nicht so wichtig“ an den Rand gedrängt werden, sind Depression und Burnout zu einem immer größeren sozialen Problem geworden. Wer malt, gestaltet, musiziert und tanzt, unterzieht sich nicht nur einer „Therapie“, sondern gewinnt einen anderen, persönlichen Zugang zu sich selbst. Die Kunst und Kultur, die sich seit eh und je um den Kern des menschlichen Lebens gekümmert haben, kehren als neue Kraft in das Leben des Menschen zurück.
Kunsttherapeutische Ausbildungen
Zum Kunsttherapeuten kann man sich auf unterschiedliche Weise ausbilden lassen.
– Universitäten und Fachhochschulen: meist pädagogischer Schwerpunkt – Akademie der Künste:
meist künstlerischer Schwerpunkt – Anthroposophische Fachschulen – Privatinstitute mit unterschiedlichen Schwerpunkten
Bei manchen Instituten ist vor Beginn der studienbezogenen Eignung ausreichende psychische Stabilität zu erbringen. Es sollten Nachweise über Erfahrung in künstlerischen und sozialen Bereichen vorhanden sein.
Voraussetzungen, um Kunsttherapeut zu werden
– Interesse an kreativer Arbeit
– Interesse an psychologischen Prozessen – Verständnis für die menschliche Psyche – Einfühlungsvermögen und Mitgefühl
– gute Beobachtungsgabe
– die Fähigkeit, motivieren zu können – Zuhör- und Kommunikationsfähigkeit – Geduld und Interesse an menschlichem Verhalten – Freude am Umgang mit Menschen – stabiles Selbst
Ansätze in der Kunsttherapie – eine Übersicht
Die verschiedenen Ansätze der Kunsttherapie lassen sich in unterschiedliche Gruppen unterteilen.
Der heilpädagogische Ansatz
In der Heilpädagogik, die sich vor allem mit behinderten Menschen beschäftigt, wird die Kunsttherapie angewendet. Hier wird die Kommunikation ohne verbale Sprache gefördert. Die Kunsttherapie beschränkt sich auf den Umgang mit bildnerisch-ästhetischen Mitteln.
Der kreativ- und gestaltungstherapeutische Ansatz
Bei diesem Ansatz werden die bildnerischen Arbeiten von Klienten miteinbezogen. Man erkennt die Bedeutung der nonverbalen Ausdrucksform und hinterfragt zum Beispiel Gedankengänge, die zur Bildidee geführt haben. Die Themenwahl des Bildes wird ganz dem Klienten überlassen.
Der anthroposophische Ansatz
Die Anthroposophie ist eine Geisteshaltung, die Rudolf Steiner in den Jahren 1921 und 1925 entwickelte. Sie vertritt eine ganzheitliche Sichtweise des Menschen. Im Bereich der Kunsttherapie sieht die Anthroposophie ihre Aufgabe darin, die Selbstheilungskräfte im Menschen zu fördern.
Der psychoanalytische Ansatz
In tiefenpsychologischen und psychotherapeutischen Ansätzen in der Kunsttherapie werden Bilder als Visualisierung psychischen Geschehens aufgefasst. Die psychoanalytische Kunsttherapie geht auf Sigmund Freud und C. G. Jung zurück, die bereits eine Beziehung zwischen dem Bildhaften und dem „Unterbewussten“ herstellten.
Ausbildung in Kreativ- und Kunsttherapie. Dozentin Christine Stettner
Die Ausbildung befähigt zur selbstständigen Durchführung von künstlerischen Therapien, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte und biografischer Krisen zum Gegenstand haben.
Inhalt der Ausbildung
– Selbsterfahrung als Kernstück der Ausbildung – Kennenlernen und Besprechung verschiedener kunsttherapeutischer Methoden – Einführung in die kunsttherapeutische Bildbetrachtung und Bildbesprechung – praktische Anwendung von kreativen Techniken – Stressbewältigung und Achtsamkeitstraining mit kunsttherapeutischen Elementen – kunsttherapeutische Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder – unterschiedliche psychologische Ansätze in der Kunsttherapie – emotionale Kunsttherapie mit der Gruppe
Beispiel: Durchführung einer Einzeltherapie. Methode: Interaktion mit positiv- und negativ besetzten Begriffen
Die Interaktion (lat. inter – zwischen, actio – Handlung) wird im Deutschen als Wechselwirkung bezeichnet. Es ist das Zusammenspiel von zwei oder mehreren Merkmalen, Variablen, Perspektiven oder Verhaltensmustern.
Anwendungsbereich: Einzeltherapie
Ziel der Methode: Förderung von Selbstvertrauen. Wahrnehmung der Zeit als natürlicher Veränderungsfaktor.
Vorbereitung/Material durch mich: Gestalten von Karten, Größe 20 x 8 cm, z. B. die Begriffe: Loslassen, Liebe, Zuversicht, Distanz, Wut, Herausforderung, Angst, Trauer,
Abb. 2: Herausforderung, Klientin Abb. 3: Mein Ziel, Therapeutin




Abb. 4: Erkenntnis, Klientin


Abb. 5: Hoffnung, Therapeutin Abb. 6: Chance, Klientin

Abb. 7: Mut, Therapeutin
Dankbarkeit, Abstand. Ölkreiden, Papier in der Größe 60 x 70 cm, Bereitstellung eines Keilrahmens, von Acrylfarben, Pinseln. Durchführung der Methode: In unserer Arbeit geht es darum, sich der inneren Sinneswelt zu widmen. Ich erkläre meiner Klientin den Prozess der Methode.
Bearbeitungstechnik: Problemlösung der Klientin: Ihre unsichere Zukunft. Meine Klientin wählt eine Karte (Begriff) aus, die ihrer momentanen Befindlichkeit entspricht. Ich bitte sie, mit Ölkreide den Begriff malerisch darunter zu gestalten. Dann „antworte“ ich auf die von ihr vorgelegte Karte (Begriff)
und male dazu das entsprechende Bild. Die Methode wird nonverbal durchgeführt.
Abb. 1 Nach der gemeinsamen Gestaltung folgt ein verbaler Austausch, der von meiner Klientin gewünscht wird.
Abb. 2: Herausforderung, Klientin Die finanzielle Situation erdrückt mich momentan. Ich fühle mich so machtlos. Es ist ein „Herztanz“ des Verzichts.
Abb. 3: Mein Ziel, Therapeutin Die Zeit als Kostbarkeit sehen, Veränderung als Ziel erkennen, konkrete Entscheidungen/ Schritte umsetzen.
Abb. 4: Erkenntnis, Klientin Ich muss meine berufliche Situation klären. Was will ich, wie kann ich meinen vielen Fähigkeiten einen Raum geben.
Abb. 5 Hoffnung, Therapeutin Selbstwertgefühl aktivieren. An sich selbst glauben. Erinnerung – was hat mein Leben bereichert? Die Freude an Neuem erkennen.
Abb. 6: Chance, Klientin
Ich muss die verschlossene Tür öffnen. Meine Einstellung ändern. Ich bin stark, ich werde den Weg gehen. Meine Chance zum „Entstehen“ lassen.
Abb. 7: Mut, Therapeutin Seelenkräfte – Fühlen und Wollen. Mut zur Entscheidung. Auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Nicht fremdbestimmt handeln. Sich entfalten, frei fühlen.
Meine Fragen an die Klientin:
– Was ist für Sie wichtig?
– Was hat sich gezeigt?
– Was motiviert Sie?
Meine Klientin entscheidet sich für das Thema Chance:
– die Chance im beruflichen Bereich – zu wissen und zu hoffen, dass sich eine neue Perspektive ergibt – nicht zu wissen, was mich erwartet, aber trotzdem meine Chance wahrnehmen – der Weg ist „geebnet“
– die Tür lässt sich weiter öffnen, ich muss es nur wollen – mein Gefühl – Neugierde und eine positive Einstellung in meine Zukunft Aufgabenstellung zum Thema Chance
Durch das Prozessverständnis besprechen wir die kreative Umsetzung des Themas Chance mit den spontan genannten Farben: Magenta, Rot, Blau, Violett.
Material zum Thema Chance:
– Keilrahmen 30 x 40 cm – Acrylfarben – schwarze Tusche
– unterschiedlich dicke Pinsel – Pappteller und Föhn
Arbeitsanweisung zum Thema Chance:
– die Rahmenfläche mit einem Schwamm anfeuchten – Farben mit dem Pinsel auf die noch feuchte Fläche malen – den Keilrahmen nach allen Seiten bewegen und die Farben fließen lassen – trocken föhnen
– Fantasiemuster mit schwarzer Tusche gestalten
Schlussbesprechung
Meine Klientin kann es kaum fassen, dass in einer relativ kurzen Zeit ein Kunstwerk entstanden ist. Sie betont, dass ihr Selbstwertgefühl Flügel bekommt. Meine Chance ist, so meine Klientin, eine verschlossene Tür öffnen zu können, spielerisch und mutig. Die Kunsttherapie ist für mich eine wunderbare gleichberechtigte Ausgewogenheit zwischen Kopf, Hand und Bauch!

Christine Stettner:
Kunst – Fantasie – Therapie. Neue Wege in der Kunsttherapie. Shaker Verlag

Christine Stettner Studium Freie Malerei und Druckgrafik, Kreativ- und Kunsttherapie, Dozentin für Kreativ- und Kunsttherapie, Ausstellungen in Europa und den USA