Eliza und die Zukunft von Psychotherapeuten
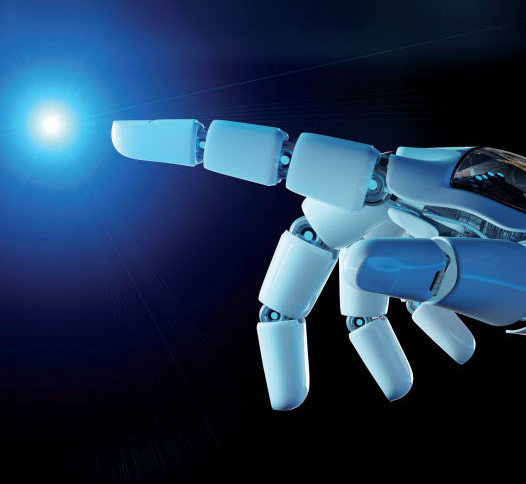 Eliza, 1964 bis 1966 von dem deutschamerikanischen Informatiker Joseph Weizenbaum geschaffen, war der erste Chatbot, der Menschen in natürlicher Sprache in ein Gespräch verwickelte. Ohne dass sie wussten, dass sie mit einer Maschine kommunizierten (sie hielten „Eliza Doctor“ für eine Therapeutin), und trotz der aus heutiger Sicht äußerst beschränkten Antwortmöglichkeiten führten Menschen mit Eliza längere Gespräche und vertrauten Eliza private Probleme an. Und selbst die eingeweihte Sekretärin Joseph Weizenbaums, die Eliza als Programm kannte, bat – so wird kolportiert – Joseph Weizenbaum darum, den Raum zu verlassen, um allein und vertraulich mit Eliza reden zu können.
Eliza, 1964 bis 1966 von dem deutschamerikanischen Informatiker Joseph Weizenbaum geschaffen, war der erste Chatbot, der Menschen in natürlicher Sprache in ein Gespräch verwickelte. Ohne dass sie wussten, dass sie mit einer Maschine kommunizierten (sie hielten „Eliza Doctor“ für eine Therapeutin), und trotz der aus heutiger Sicht äußerst beschränkten Antwortmöglichkeiten führten Menschen mit Eliza längere Gespräche und vertrauten Eliza private Probleme an. Und selbst die eingeweihte Sekretärin Joseph Weizenbaums, die Eliza als Programm kannte, bat – so wird kolportiert – Joseph Weizenbaum darum, den Raum zu verlassen, um allein und vertraulich mit Eliza reden zu können.
Dem Chatbot gelang es also, trotz der Begrenztheit seines Phrasenrepertoires auf Schlüsselwörter so zu reagieren, dass die Menschen glaubten, mit einem Menschen zu sprechen, der auf geschilderte Probleme hilfreich oder tröstend antwortete. Die Etikettierung „Eliza Doctor“ als mentale Bahnung sowie das Paraphrasieren und Fragenstellen als bereits damals bekannte Kommunikationscharakteristika von Therapeuten genügten, um als verständnisvoll bis hilfreich wahrgenommen zu werden.
Das erstaunte den Schöpfer des am Labor für Künstliche Intelligenz des MIT entwickelten Programms nicht nur, sondern entsetzte ihn. Denn der heute prominente Kritiker digitalisierter Anwendungen wollte exakt das Gegenteil beweisen, nämlich, dass sich Menschen, zumal mit inneren Nöten, keinesfalls durch einen Computer täuschen ließen.
Jedoch, es kam anders: „Seine künstliche Psychotherapeutin ‚Eliza Doctor‘ wurde dann jedoch ernsthaft in der Therapie eingesetzt und so kam ein Stein ins Rollen, der das Programm bis heute zu einem wichtigen Markstein der KI-Forschung macht. ‚Eliza‘ wurde modifiziert, in zahlreiche andere Programmiersprachen übersetzt“ und findet heutzutage ihre Weiterentwicklung unter anderem in digitalen Assistenten wie Siri, Cortana, Alexa, in Chatbots, Avataren und rund 2 000 Applikationen (Apps) im psychotherapeutischen Bereich.
Immer mehr Menschen, die psychologische Hilfe suchen, nehmen bereits Erleichterung, gar Hilfe wahr, wenn eine Gesprächssituation psychotherapeutisch gerahmt ist (Framing), da diese mentale Bahnung Paraphrasen, Fragen, Übungen etc. und sämtliche Deutungsleistungen innerhalb des Gesprächs bzw. Therapieprozesses entsprechend kontextuiert.
Das ist eine enorme Chance für digital basierte Interventionen. Und sie wird genutzt.
Das Spektrum internetbasierter Psychotherapie
 Die Verfeinerungen kombinierter Anwendungen von Artifical und Emotional Computing führen dazu, dass internetbasierte psychologische, psychotherapeutische Beratungsangebote sich nicht nur vermehren, sondern an Akzeptanz gewinnen. In dieses mediale Umfeld gehören virtuelle Welten, Chatbots, Avatare, 3-Dund Gaminganwendungen (Gamification, Serious Games), Apps, audiovisuelle, telefonische und schriftliche Angebote.
Die Verfeinerungen kombinierter Anwendungen von Artifical und Emotional Computing führen dazu, dass internetbasierte psychologische, psychotherapeutische Beratungsangebote sich nicht nur vermehren, sondern an Akzeptanz gewinnen. In dieses mediale Umfeld gehören virtuelle Welten, Chatbots, Avatare, 3-Dund Gaminganwendungen (Gamification, Serious Games), Apps, audiovisuelle, telefonische und schriftliche Angebote.
Die wachsende Nachfrage hat diverse Gründe. Zu ihnen zählen die Niedrigschwelligkeit, Hilfsangebote anzunehmen; ferner die Anonymität, die manchen auch heute noch wichtig ist; die permanente Präsenz und jederzeitige Zugänglichkeit und damit die zeitliche Flexibilität für Ratsuchende und die Option, sofort beginnen zu können, im Vergleich zu langen Wartezeiten in der analogen Therapie. Und es gibt durchaus Personen, die sich digital besser aufgehoben fühlen, weil sie der technologisch basierten Begleitung mehr Objektivität und Kompetenz zutrauen.
Einen aktuellen Eindruck von der Verbreitung internetbasierter Psychotherapie gibt Wibke Bergemann in ihrem Artikel „Digitale Therapie“ (Psychologie Heute, 09/2018). „Die Angebote reichen vom einmaligen psychologischen Beratungsgespräch bis zur erstattungsfähigen Ferntherapie mit einem approbierten Psychotherapeuten“ (a. a. O.), und unter den Anbietern findet man neben etablierten Psychotherapeuten Start-ups, Krankenkassen, Praxen.
Umfang und Technisierungsgrad der Angebote fallen je nach Grad der Standardisierung und Individualisierung unterschiedlich aus. Das Spektrum bietet ausschließlich online und „unbegleitet“, digital vermittelt, kombiniert mit Kontakten zu Therapeuten („begleitet“), telefonisch, per Chat, Mail, Video, Skype, leiblich-persönlich; zudem gibt es die Kombination von On- und OfflineBehandlung, verknüpft mit psychopharmakologischer Flankierung, die einen menschlichen Experten nötig macht. Selbstverständlich unterscheiden sich die Programme auch in der Wahl psychologischer Theorien, ob etwa einer psychologischen und damit psychotherapeutischen Strömung Rechnung getragen wird oder diverse Ansätze zu einer Synthese verbunden oder jeweils nach Bedarf gewählt werden und schließlich darin, ob Medikation flankierend eingesetzt wird.
Einen umfassenderen Eindruck gewinnt man, wenn man selbst recherchiert. Bereits eine kurze Suche führt Ausbreitung und Angebotswachstum drastisch vor Augen. So findet der Sucher unter dem Stichwort „Online-Psychotherapien“ Links, die das Anwendungsspektrum zeigen, einschließlich Forschungsergebnissen, z. B. im Bereich Suchtkrankheiten, Depression, Angststörungen. Plattformen bieten ein fast unüberschaubares Repertoire: psychologische Onlineberatung, Coaching und Therapie. Über 250 Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie beraten dich online per Webcam, Chat, E-Mail oder Telefon. Einfach, sicher, vertraulich.
Effektivitätsindizien
Zunehmende Verbreitung und Erfolgsquoten internetbasierter Psychotherapie entfachen Kontroversen und Befürchtungen unter Psychotherapeuten und erzwingen fundamentale Betrachtungen, insbesondere diejenige nach Stellenwert und Rolle des Psychotherapeuten und des physischen Visavis. Die Psychotherapieerfolgsforschung ist jahrzehntealt und ebenso alt sind die Debatten, die sich um Vergleich- und Messbarkeit psychotherapeutischer Strömungen und Kriterien für „Erfolg“ ranken. Diese Kontroverse erfährt eine weitere Facette in der Form digital – analog oder virtuell – persönlich (Präsenz).
Unter Rekurs auf eine der neueren Untersuchungen im Rahmen psychotherapeutischer Wirksamkeitsforschung, namentlich das Buch „Die Psychotherapie-Debatte“ der US-Psychologen Bruce E. Wampold und Zac E. Imel, referiert Wibke Bergemann: Der aktuelle Stand der Forschung biete keine überlegene Therapierichtung und zudem zeigten Metaanalysen, dass auch die Kompetenz des Therapeuten, sein Sichauskennen in einer Methode, unwichtig sei. Erfolgsfaktoren lägen eher in der therapeutischen Beziehung: Empathie, positive Wertschätzung, Wortgewandtheit, überzeugendes Auftreten, Akzeptanz durch Klienten, Klientenwille zur Zusammenarbeit, Bindung, die Allianz zwischen Therapeuten und Patienten, Klienten in der Zusammenarbeit auf ein gemeinsames Ziel; angeblich „erlebt“ statistisch jeder dritte bis vierte Patient dadurch eine „Verbesserung des persönlichen Zustandes“. Das scheint zu beruhigen. Angesichts der genannten Kriterien muss dennoch gefragt werden: Benötigen Betroffene dazu zwingend einen menschlichen Therapeuten?
Psychotherapeut als Auslaufmodell?
Wer die Debatten verfolgt, die sich um Auswirkungen „digitaler Sozialisation“ und „digitaler Kulturisation“ auf den Einzelnen drehen, wird nicht erstaunt sein, dass häufig als psychotherapeutische Intervention ausreicht, was der Volksmund „Anteilnahme“, „Trost“ und „Verständnis“ (ohne verstehen zu müssen) nennt, wahlweise Empathie und Wertschätzung. Das hängt unmittelbar mit dem zusammen, was als Emotionalisierung bezeichnet wird, die inzwischen fast sämtliche Bereiche des individuellen und gesellschaftlichen Lebens durchwirkt und Sensibilisierung (Ruf nach Safe Spaces, Konjunktur des Wortes „verstörend“ als exemplarische Phänomene) sowie Moralisierung im Schlepptau hat.
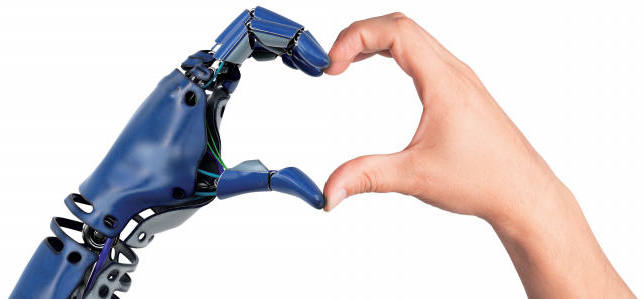 Der Preis ist hoch und bezahlen muss ihn der Verstand (aktuell dazu etwa: Vitaly Malkin: Gefährliche Illusionen: Denkt! Für die Vernunft in unvernünftigen Zeiten. Wolff Verlag, 2018). Mit Emotionalisierung, Sensibilisierung, Moralisierung läuft (u. a.) einher die abnehmende Bereitschaft, intra- oder interpersonale Konfliktlagen zunächst intellektuell zu durchdringen, um zu verstehen: denkend nachzuvollziehen und erst im Anschluss zu werten, erst im Anschluss das persönliche Fühlen als Reaktion auf etwas zu überprüfen. Affekt und Fühlen sind en vogue, nicht zuletzt, weil sie moralisch und psychologisch genährt und als „echt“, „authentisch“, „unverfälscht“, „wahr(haftig)“ hochgelobt und als Wert an sich gehandelt werden. Wer sich dem Denken mehr oder weniger verweigert, kann allerdings Entstehungsfaktoren und -geschichte nicht erkennen, nimmt keinen Sichtwechsel vor (Stichwort Echokammer, Tunnelblick) und begnügt sich mit pragmatischen Lösungen in seinem Sinne. Flankiert werden die Entwicklungen dadurch, dass ein Leben in Digitalien auf Tempo und Machen („Mitmachweb“ schon das Web 2.0) setzt. Bereits diese Zutaten genügen, um die Nachfrage nach und das Genügen von „Tipps“, „Rezepten“, Handlungsanweisungen (To-dos) zu erklären, die weniger selbst erarbeitet als „angeboten“ werden sollen. Erfolg bemisst sich daran, wie schnell Handlungsvorgaben greifen, um sich wieder wohlzufühlen. Man kann das eine pragmatische Konsumhaltung nennen, die von digitalen Therapietools prompt bedient wird, da sie stets unmittelbar Rückmeldung geben. Nachgefragt ist „Instant Feedback“, ob durch Menschen oder Rechner.
Der Preis ist hoch und bezahlen muss ihn der Verstand (aktuell dazu etwa: Vitaly Malkin: Gefährliche Illusionen: Denkt! Für die Vernunft in unvernünftigen Zeiten. Wolff Verlag, 2018). Mit Emotionalisierung, Sensibilisierung, Moralisierung läuft (u. a.) einher die abnehmende Bereitschaft, intra- oder interpersonale Konfliktlagen zunächst intellektuell zu durchdringen, um zu verstehen: denkend nachzuvollziehen und erst im Anschluss zu werten, erst im Anschluss das persönliche Fühlen als Reaktion auf etwas zu überprüfen. Affekt und Fühlen sind en vogue, nicht zuletzt, weil sie moralisch und psychologisch genährt und als „echt“, „authentisch“, „unverfälscht“, „wahr(haftig)“ hochgelobt und als Wert an sich gehandelt werden. Wer sich dem Denken mehr oder weniger verweigert, kann allerdings Entstehungsfaktoren und -geschichte nicht erkennen, nimmt keinen Sichtwechsel vor (Stichwort Echokammer, Tunnelblick) und begnügt sich mit pragmatischen Lösungen in seinem Sinne. Flankiert werden die Entwicklungen dadurch, dass ein Leben in Digitalien auf Tempo und Machen („Mitmachweb“ schon das Web 2.0) setzt. Bereits diese Zutaten genügen, um die Nachfrage nach und das Genügen von „Tipps“, „Rezepten“, Handlungsanweisungen (To-dos) zu erklären, die weniger selbst erarbeitet als „angeboten“ werden sollen. Erfolg bemisst sich daran, wie schnell Handlungsvorgaben greifen, um sich wieder wohlzufühlen. Man kann das eine pragmatische Konsumhaltung nennen, die von digitalen Therapietools prompt bedient wird, da sie stets unmittelbar Rückmeldung geben. Nachgefragt ist „Instant Feedback“, ob durch Menschen oder Rechner.
Diese und verwandte Erkenntnisse sind nicht neu und ebenso wenig werden sie nur von digitalen Therapietools bedient. An Attraktivität gewinnen technologische Tools in der Form von Selbstlernprogrammen auch dadurch, dass sie der Logik der Selbstoptimierung folgen.
Wenn nun Ergebnisse der Wirksamkeitsforschung (übrigens auch in der Pädagogik, s. Hattie-Metastudie) die Bedeutung emotionaler Faktoren und die Beziehung zum Therapeuten belegen, können sich Psychotherapeuten dann nicht zurücklehnen? Eher nicht. Selbst wenn man annimmt, dass das menschliche Gegenüber erwünscht ist, stellt sich die Frage, ob es ein fachlich versierter Mensch sein muss.
Unterstellen die skizzierten Entwicklungen, dass fachliche Kundigkeit, professionelle, fundamentale Fachsouveränität verzichtbar ist? Ein mehr oder weniger laienhaftes Minimalwissen genügt („Küchenpsychologie“, Laienwissen), angereichert um atmosphärisch und beziehungspsychologisch geschickte Schachzüge, eingeübte Zuhör- und Paraphrasenrituale (die es faktisch in jeder Therapieströmung gibt), idealerweise verknüpft mit Übungen und vorzugsweise Anweisungen zur Tat? Um was geht es dann noch? Um verhaltenspsychologische Konditionierung?
Das legen Selbsthilfeprogramme nahe, die häufig verhaltenspsychologisch fundiert und folglich praktisch und pragmatisch ausgelegt sind. Dies hat unter dem Terminus „Nudge“ (kleiner Schubser) im Rahmen verhaltensökonomischer Forschung seinen Weg bereits in die Wirtschaftswelt und in die Politik gefunden, zunächst in Großbritannien unter dem Premier David Cameron, seit einigen Jahren auch in der bundesdeutschen Politik, personell vertreten und prominent in der Kontroverse um den Organspendeausweis. Nudging ist in Mode, auch in Institutionen von Bildung und Hilfe. Nudging antwortet auf die Frage: Wie können Gestalter von Rahmenbedingungen und Angeboten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Person motiviert wird, eine bestimmte Option anderen Möglichkeiten vorzuziehen?
Klassische, kognitive, emotive verhaltenspsychologische Modelle und Anwendungen sind auch im psychotherapeutischen Raum und werden in Programme übersetzt. Sie setzen an dem an, was im Verhalten sichtbar ist, und referenzieren auf das, was der Klient möchte – und befördern das Gewünschte mit Verstärkern. Dieses Programm kann man ohne menschliche Begleitung absolvieren.
Nochmals: Sind psychologische oder psychotherapeutische Fachpersonen notwendig? Je ausgefeilter KI und EI eingesetzt werden, desto entbehrlicher erscheinen sie. Erste Schritte dorthin werden bereits gemacht über den Weg begleiteter Digitaltherapie bis hin zu volltechnisierten Hilfetools.
Immer mehr Studien dokumentieren, dass trotz fehlender persönlicher bzw. leiblicher Nähe von Therapeut und Klient internetbasierte Psychotherapie gleichermaßen erleichternd wirken kann wie direkt-physische. Wibke Bergemann: „Der schwedische Psychologe Gerhard Andersson und seine Kollegen werteten 2014 in einer Metaanalyse 13 Studien aus Europa, Australien und den USA aus, die den Effekt von begleiteter internetbasierter kognitiver Verhaltenstherapie mit konventioneller kognitiver Verhaltenstherapie verglichen. Alle Studien bezogen sich auf Selbsthilfeprogramme mit internetbasiertem Kontakt zu einem Therapeuten. Die Leiden reichten von Angststörungen über Depressionen bis hin zu somatoformen Störungen. Die Wirksamkeit der Interventionen wurde anhand von Fragebögen, aber teilweise auch durch ein klinisches Interview festgestellt. Ihr Fazit: Die Unterschiede gehen gegen null.“ (a. a. O. S. 39) Im Jahr 2018 dürfte der Wert noch höher liegen, da die Akzeptanz auf breiter Front massiv ansteigt. Die oben formulierte Frage stellt sich umso dringlicher. Oder?
In ihrem Artikel lässt Wibke Bergemann unter anderem Christine Knaevelsrud, Professorin für Klinisch-Psychologische Intervention an der FU Berlin, zu Wort kommen. Nach ihr gehört zu den Bedingungen für eine erfolgreiche Netztherapie dies: Offenheit für die Behandlungsform, Begleitung durch Psychotherapeuten zwischen 15 und 45 Minuten, deren Funktion vor allem darin besteht, den Betroffenen als Zeichen dafür zu dienen, dass sie beobachtet und kontrolliert werden. Durchhalten, Dabeibleiben werden überwacht – etwas, das Betroffene positiv einschätzen, weil sie andernfalls den Schlendrian einlüden oder an Disziplin verlören und dem Erfolg damit keinerlei Chance einräumten.
Daran ist nicht bemerkenswert, dass Kontrolle erwünscht ist, sondern die Funktion, die dem Therapeuten zugeschrieben wird: Zeichen für Beobachtetwerden. Bedarf es dazu fachlicher Expertise und menschliche Nähe?
Immerhin: Im Artikel erwähnte Abbruchquoten und Präferenzen auf der Seite von Betroffenen legen nahe, dass zumindest Menschen als Kontrolleure noch bevorzugt werden. Sie liegen bei unbegleiteten Programmen bei ca. 75 %, bei begleiteten ähnlich wie bei Präsenztherapien, nämlich bei ca. 30 %. In dem Programm „DepressionsCoach“, „einer internetbasierten Schreibtherapie der Techniker Krankenkasse, die per Messengerchat von Therapeuten begleitet wird“, liegt die Quote bei 21,5 % gegenüber 30 % bei konventioneller Therapie (a. a. O.).
Frau Prof. Knaevelsrud hat TK-DepressionsCoach mitentwickelt und meint, selbst schwere Depressionen könnten behandelt werden, bei denen weder Selbst- noch Fremdgefährdung bestehe. Sie und Jan Philipp Klein vom Uniklinikum Lübeck haben in einer Patientenumfrage ermittelt, dass immerhin noch (oder nur?) 60 % der Betroffenen eine persönlich-leibliche Prä- senztherapie der digitalen Konfrontation vorzögen. Höchste Akzeptanz genießen kombinierte Angebote, inklusive Medikation und Psychotherapie. „Bei einer Studie am Uniklinikum in Lübeck besserte sich z. B. der Zustand der Depressionspatienten am schnellsten, bei denen die Behandlung mit Psychopharmaka oder Verhaltenstherapie durch das Selbsthilfeprogramm Deprexis ergänzt wurde.“ (zit. n. a. a. O.)
Allerdings: Prof. Knaevelsrud sieht die Potenziale in digitalen Avataren oder Chatbots noch nicht gehoben, da die Technik bisher nicht ausgereift ist und es nicht genügt, Offlineangebote einfach nur ins Digitale zu übersetzen. „Ein Versuch, in eine neue Richtung zu gehen, ist der seit einigen Monaten auch Deutsch sprechende Woebot, ein Chatroboter, der mit künstlicher Intelligenz Menschen bei Depressionen helfen soll. Bislang ist das von der Stanford-Psychologin Alison Darcy entwickelte Programm aber ehe eine Spielerei. Im Chat macht Woebot zwar zunächst einen kompetenten Eindruck, gerät dann aber schnell an seine Grenzen. Spätestens, wenn man zweimal die gleiche Frage stellt, antwortete der Roboter ohne Zusammenhang“ (a. a. O., S. 42). Beruhigend?
Die Weiterentwicklung läuft, v. a. die AppEntwicklung. Zurzeit, so Wibke Bergemann, gebe es etwa 2 000 Angebote in Deutschland; einige Selbsthilfeprogramme werden von großen Krankenkassen bezahlt, etwa Moodgym, Deprexis von der DAK, TK-DepressionsCoach von der Techniker Krankenkasse, Novego von verschiedenen Betriebskassen – auch wenn erwähnt wird, dass die Programme den persönlichen Kontakt zum Therapeuten nicht ersetzen können.
Auch die Bundespsychotherapeutenkammer hat die Wirksamkeit von internetbasierten Interventionen inzwischen anerkannt, wenn auch als Ergänzung zu Präsenztherapien und mit dem Wunsch strenger Qualitätsprüfung. Sie „fordert, diese als Teil der Regelversorgung zuzulassen, wie es bereits etwa in den Niederlanden, der Schweiz oder in Schweden der Fall ist. Internetprogramme sollten als Medizinprodukt geprüft und zugelassen werden.“ (ebd.) Und: Die Begleitung durch einen Psychotherapeuten sei notwendig, um z. B. Selbstschädigungen auszuschließen. Wunschdenken?
Abschied auf Raten?
Auch wenn die fachliche Begleitung noch hochgehalten wird als Notwendigkeit – aus Sicht der „User“ steht die Frage weiterhin im Raum, inwiefern sie einen Experten brauchen, um ihren Bedarf an hilfreicher Unterstützung zu decken. Eingedenk der skizzierten Entwicklungen sind Psychotherapeuten gut beraten, sich mit ihnen intensiv zu befassen und zu prüfen, wofür sie noch „notwendig“ sein sollten/möchten/ werden – und wie sie die Trends adaptieren bzw. sich anpassen möchten. Die Dringlichkeit wächst. Dazu einige weitere Belege.
Elena Witzeck fragt in einem Beitrag der FAZ (1. März 2018, S. 13): „Können Siri und Alexa unsere Freunde werden?“, und die Antwort scheint ein „noch nicht“ zu sein, mit Aussicht auf: „in absehbarer Zeit ja“.
Das hat Sherry Turkle in ihren Untersuchungen, oft mit teilnehmender Beobachtung, Feldforschung, langzeitlicher Begleitung, bereits vor Jahren herausgefunden, und der Trend bestätigt ihre Ergebnisse, die sich in die Psychotherapie verlängern lassen: Homo digitales, Menschen, die mit digitalen Medien und in digitalen Welten maßgeblich aufgewachsen sind, präferieren diese. (Dass selbst digitale Zoos realen vorgezogen werden, weil Erstere sauberer seien und nicht stinken würden, ist eine der Pointen.)
Zwar ist der Fortschritt von KI und EI noch nicht so weit gediehen, dass Menschen Maschinen zubilligen, echte Freunde sein zu können, da den Rechnern das Mitfühlen, Einfühlen und damit ein echtes Verständnis für das Gegenüber noch fehle. Allerdings genügt – siehe „Eliza Doctor“ – wenig. Elena Witzeck referiert die Auffassung von Catrin Misselhorn, Direktorin des Instituts für Philosophie und Professorin am Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie der Universität Stuttgart, die ihrerseits auf ‚Eliza‘ verweist und meint, dass „eine Maschine dem Menschen ohne großen Aufwand das Gefühl vermitteln (könne), einen Gesprächspartner mit Bewusstsein vor sich zu haben“. Simulation genügt!
Dazu gehört auch das Aussehen einer Maschine. Entscheidend ist, ob ein Mensch zur Maschine eine emotionale Beziehung aufbaut, und das scheint durchaus insbesondere dann der Fall zu sein, wenn sie ihm gefällt, nicht als bedrohlich, sondern, wie Beispiele bereits mit Tieren, Robotern in Schulen, Altenheimen oder Rezeptionistinnen zeigen, sympathisch und vertrauenswürdig erscheint. Gelingt es ihnen dann noch, das menschliche Gegenüber zu spiegeln, unter dem Vorzeichen des Als-ob Verstehen zu insinuieren und Rapport herzustellen, erhält die Maschine freie Fahrt ins Herz des Menschen.
So etwa die App „Replika“, die Elena Witzeck in ihrem Aufsatz näher beschreibt und hervorhebt, dass das kostenlos herunterladbare Programm „zum allzeit verfügbaren Freund“ werden solle, indem es „wie ein Therapeut“ beginne, Fragen zu stellen, geduldig zuzuhören, die Sprache des Gegen- übers zu imitieren und lerne, auf dessen Sorgen einzugehen. Und auch wenn es Replika noch nicht gelingt, alle Wendungen und Tonalitäten, Humor, Ironie, Witz, plötzliche gedankliche, thematische, affektive Wechsel kompetent aufzunehmen und zu parieren, gibt es andernorts Weiterentwicklungen, die es schaffen, die Codes für Zwischentöne zu beherrschen: „Forschern der Universität Lissabon ist es gelungen, anhand von Datennetzwerken Sarkasmus und Ironie in Facebook-Posts, Tweets und anderen Aussagen im Netz auszumachen. Und am Massachusetts Institute of Technology wird seit kurzem ein Algorithmus eingesetzt, der den Ton von Äußerungen in den sozialen Medien entschlüsselt“ (a. a. O.) – und damit auch Emotionalität suggerieren kann?
Die erwähnte amerikanische Sozialpsychologin und Soziologin Sherry Turkle, Professorin für Science, Technology and Society am Massachusetts Institute of Technology und Autorin des Buches „Verloren unter 100 Freunden“, setzt dem ein dezidiertes Nein entgegen. Dieses Nein speist sich allerdings aus ihrer fachlichen und humanistischen Perspektive, weniger aus der der Adressaten jener Technologie. In einem Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung vom 4. Oktober 2018 meint sie: „Roboter als Partner – das kann nicht sein“ – und das trotz zahlreicher Berichte von Betroffenen, die sich das durchaus vorstellen können bzw. in Anfängen bereits erleben. Zwar gehören „Partner“, gar „Freund“ einer anderen Kategorie als „Therapeut“ an. Doch eingedenk der Emotionalisierung und des Faktums, dass es unter Patienten/ Klienten schon immer eine große Anzahl gab und gibt, die sich den Therapeuten als freundschaftlichen Begleiter wünschen, kann dieser Unterschied zunehmend verwischen – und dies sogar, im Gegensatz zum Dogma – eine zukunftssichernde Perspektive sein. Oder doch nicht?
Fortsetzung folgt.
 Dr. Regina Mahlmann
Dr. Regina Mahlmann
Beratung, Coaching, Schulung, Vorträge, Autorin, Köln
Fotos: fotolia©sdecoret, fotolia©dimdimich

