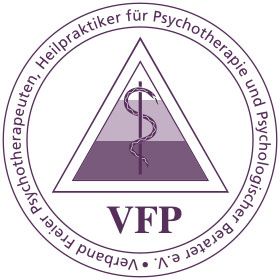Psychoanalytisches Vorgehen bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten
EINE SINNVOLLE METHODE?
Das von Außenstehenden gern als unangemessen bewertete Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist oft Ausdruck ihrer inneren Konflikte, die auf vielfältige Ursachen zurückzuführen sind. Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression, Rückzug oder Impulsivität sind nicht selten ein Hilfeschrei. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein psychoanalytisches Vorgehen bei solchen Auffälligkeiten eine geeignete Interventionsmöglichkeit darstellen kann.
Das von Außenstehenden gern als unangemessen bewertete Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist oft Ausdruck ihrer inneren Konflikte, die auf vielfältige Ursachen zurückzuführen sind. Verhaltensauffälligkeiten wie Aggression, Rückzug oder Impulsivität sind nicht selten ein Hilfeschrei. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ein psychoanalytisches Vorgehen bei solchen Auffälligkeiten eine geeignete Interventionsmöglichkeit darstellen kann. Doch eignet sich dieser therapeutische Ansatz tatsächlich für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche?
BEDARFSLAGE: AKTUELLE ZAHLEN
Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die psychiatrische und/oder psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, liegt auch nach der Coronapandemie weiterhin auf einem hohen Niveau. So ergab sich eine Neudiagnoserate psychischer Erkrankungen mit Verhaltensstörungen (ICD-10 F) bei 1000 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2022 in der Gruppe der Grundschulkinder (5 bis 9 Jahre) von 9,45%, in der Gruppe der Schulkinder (10 bis 14 Jahre) von 7,18% und in der Gruppe der Jugendlichen (15 bis 17 Jahre) von 9,68%. Die Zahlen sind damit im Vergleich zum Jahr 2021 rückläufig, aber immer noch deutlich höher als vor der Pandemie im Jahr 2019 (je nach Gruppe zwischen 3 bis 6% mehr – DAK Kinder- und Jugendreport, 2023).
WAS VERSTEHT MAN UNTER VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN?
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen umfassen ein breites Spektrum von Verhaltensweisen, die sich deutlich vom typischen Verhalten Gleichaltriger unterscheiden. Dazu zählen Aggressionen, oppositionelles Verhalten, Aufmerksamkeitsstörungen oder soziale Isolation. Solche Auffälligkeiten können verschiedene Ursachen haben, wie familiäre Spannungen, schulische Überforderung oder traumatische Erlebnisse. Oftmals zeigen Kinder und Jugendliche diese Verhaltensweisen als Reaktion auf eine emotionale Überforderung oder als Ausdruck ungelöster innerer Konflikte.
Allgemein kann man also sagen, dass Verhaltensauffälligkeiten sich auf Abweichungen im Verhalten von Kindern und Jugendlichen beziehen, die deutlich von den altersentsprechenden sozialen Normen abweichen und von Eltern, Lehrern oder anderen Erziehungspersonen als problematisch wahrgenommen werden. Diese Verhaltensweisen können sich in verschiedenen Bereichen zeigen wie im sozialen Verhalten, in der Regulation der Emotionen oder im schulischen Kontext. Aus pädagogischer Sicht spricht man von Verhaltensauffälligkeiten, wenn das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen wiederholt oder über einen längeren Zeitraum hinweg auftritt und dadurch das Lernen, das Wohlbefinden oder die Integration in soziale Gruppen beeinträchtigt wird.
Oft sind Verhaltensauf- fälligkeiten die Reaktion auf eine emotionale Überforderung oder Ausdruck ungelöster innerer Konflikte.
Es handelt sich also nicht um einmalige oder kurzfristige Verhaltensweisen, sondern um wiederkehrende Muster, die auf tiefere emotionale, psychische oder soziale Probleme hinweisen.
PSYCHOANALYTISCHES VORGEHEN: EIN TIEFER BLICK IN DIE SEELE
Ein psychoanalytisches Vorgehen zielt darauf ab, unbewusste Konflikte, die sich hinter auffälligem Verhalten verbergen, zu entschlüsseln und zu bearbeiten. Diese Herangehensweise basiert auf der Annahme, dass vergangene Erfahrungen – insbesondere in der frühen Kindheit – das Verhalten und Erleben eines Menschen maßgeblich beeinflussen. Hierbei wird auch die Beziehung zu den Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen, z. B. zu Erzieherinnen oder Lehrkräften, in den Blick genommen. Im Folgenden werden klassische psychoanalytische Erklärungsansätze genauer erläutert.
ÜBERTRAGUNGSPROZESSE UND WIDERSTAND
Generell sind in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die gleichen psychoanalytischen Phänomene zu beobachten wie bei der Therapie von Erwachsenen. So sind z. B. die Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse zu nennen. Kinder und Jugendliche können Gefühle und Verhaltensmuster, die sie gegenüber ihren Eltern zeigen, unbewusst auf Lehrkräfte und Erzieher übertragen. Ein Kind, das z. B. eine problematische Beziehung zum Vater hat, könnte mit männlichen Lehrkräften in Konfliktsituationen geraten, weil es männliche Autoritätspersonen ablehnt und sich folglich oppositionell verhält.
Auch das psychologische Phänomen des Widerstandes ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu beobachten. Wenn sich ein Kind weigert, zu lernen, oder sich destruktiv verhält, könnte dahinter ein Widerstand gegen unbewusste Konflikte versteckt sein, wodurch es daran gehindert wird, sich auf schulische Aufgaben zu konzentrieren. Dieser Widerstand könnte eine Abwehr entweder der Angst vor dem Scheitern oder der Angst vor dem Verlust von elterlicher/pädagogischer Aufmerksamkeit sein (z. B. krankheitsbedingte Zuwendung).
UNBEWUSSTE KONFLIKTE UND ABWEHRMECHANISMEN
Unbewusste Konflikte sind nach der psychoanalytischen Lehre eine der Hauptursachen von psychischem Leiden. Bei der sog. Konfliktpathologie wird davon ausgegangen, dass psychische Konflikte, die zwischen widersprüchlichen inneren Wünschen, Bedürfnissen oder moralischen Vorstellungen bestehen, nicht immer bewusst wahrgenommen werden. Wenn diese Konflikte nicht gelöst oder verarbeitet werden, können sie zu verschiedenen Formen von psychischen Störungen führen. Denn um einen inneren Konflikt zu umgehen, entwickelt das Ich (vgl. Strukturmodell der Psyche; Freud, 1923) verschiedene Abwehrmechanismen. Diese Mechanismen können kurzfristig helfen, das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Instanzen (Es, Ich und Über-Ich) und der Realität zu halten, aber langfristig wiederum zu psychischen Problemen führen. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie kann man häufig folgende Abwehrmechanismen beobachten:
Verschiebung: Kinder können eigene, unangenehme Gefühle oder Impulse (un-)bewusst auf andere Kinder übertragen. Ein Schüler, der sich z. B. aggressiv gegenüber anderen verhält, könnte seine Aggressionen, die er gegenüber seinem Bruder oder seinem Vater hegt, aber nicht zulassen möchte oder darf, auf seine Mitschüler verschieben.
Regression: In stressigen oder belastenden Situationen kann ein Kind oder Jugendlicher auf frühere Entwicklungsstufen zurückfallen. Dies äußert sich in Verhaltensweisen, die nicht dem aktuellen Alter entsprechen, wie Daumenlutschen, extremes Trotzverhalten, Einnässen. Regression ist ein Abwehrmechanismus, der dem Kind hilft, mit überfordernden Emotionen oder Frustrationen umzugehen.
Reaktionsbildung: Bei diesem Abwehrmechanismus verwandelt eine Person (in der Regel unbewusst) einen starken, aber unerwünschten Impuls oder Wunsch in das Gegenteil und bringt diesen dann zum Ausdruck. Ein Jugendlicher, der unbewusst kindliche Bedürfnisse oder Abhängigkeit als schwach oder peinlich empfindet, könnte eine übertrieben „erwachsene“ Haltung einnehmen. Beispielsweise könnte er sich besonders rational und distanziert verhalten, um seine kindliche Seite abzuwehren.
FRÜHKINDLICHE TRAUMATA UND UNBEWUSSTE WIEDERHOLUNG
Auch frühkindliche Traumatisierungen können dazu führen, dass Kinder und Jugendliche Auffälligkeiten in ihrem Erleben und Verhalten zeigen. So können frühkindliche Trennungs- und Deprivationserfahrungen von Bezugspersonen (z. B. Scheidung der Eltern, Tod eines Elternteils, emotionale Vernachlässigung) dazu führen, dass das Kind/der Jugendliche starke Verlustängste entwickelt. Diese Ängste werden dann durch klammerndes Verhalten, sozialen Rückzug oder auch Wut geäußert. Solche Verhaltensweisen sind oft Versuche, mit den schmerzhaften Gefühlen von Verlust und Unsicherheit umzugehen. Kinder können belastende oder traumatische Erlebnisse (z. B. körperliche Misshandlungen) aber auch verdrängen. Das bedeutet, dass diese Erlebnisse ins Unbewusste verschoben werden, um das Bewusstsein zu entlasten. Diese verdrängten Inhalte können jedoch durch auffälliges Verhalten zum Vorschein kommen, wenn sie (genauer gesagt die damit verbundenen Gefühle) durch gewisse Situationen, Personen usw. reaktiviert werden. Ein Kind, das häufig Wutanfälle bekommt, könnte unbewusst auf verdrängte Gefühle der Hilflosigkeit oder Angst reagieren.
Kinder und Jugendliche neigen manchmal dazu, bestimmte unangenehme oder traumatische Erlebnisse und Verhaltensmuster unbewusst zu wiederholen, selbst wenn diese Wiederholungen Leid verursachen. Dieses Phänomen wird in der Psychoanalyse als „Wiederholungszwang“ bezeichnet. In der Regel ist der Wiederholungszwang mit traumatischen Erlebnissen verbunden, die nicht ausreichend verarbeitet wurden. Statt das Trauma bewusst zu verarbeiten und abzuschließen, manifestiert es sich immer wieder in neuen Situationen. Eine Jugendliche, die in ihrer Kindheit bspw. unter einem autoritären Elternteil gelitten hat, könnte immer wieder Beziehungen zu dominanten Partnern/Klassenkameraden suchen und eingehen, obwohl diese Beziehungen/Freundschaften ihr schaden. Man könnte das damit erklären, dass die junge Frau auf einer unbewussten Ebene versucht, das Trauma der Vergangenheit zu „bewältigen“, indem sie es erneut durchlebt – in der Hoffnung, es dieses Mal anders zu bewältigen.
PSYCHOANALYSE UND VERHALTENS-AUFFÄLLIGKEITEN – PASST DAS NUN ZUSAMMEN?
Ob psychoanalytische Ansätze bei der Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten zielführend sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Kritiker werfen der Psychoanalyse oft vor, sie sei zu theoretisch und langwierig, um akute Verhaltensprobleme wirksam anzugehen. Befürworter weisen im Gegensatz dazu darauf hin, dass gerade bei tief verankerten psychischen Problemen die Auseinandersetzung mit unbewussten Konflikten zwingend notwendig ist, um langfristig eine Veränderung des Verhaltens zu bewirken.
Ein wichtiger Aspekt bei der Anwendung psychoanalytischer Methoden bei Kindern und Jugendlichen ist die Anpassung des Verfahrens an die jeweilige Entwicklungsstufe. Bei jüngeren Kindern kommen häufig spieltherapeutische Elemente zum Einsatz, während bei Jugendlichen Gespräche und Assoziationen eine größere Rolle spielen. Hier kann die Psychoanalyse helfen, ein tieferes Verständnis für die familiären und sozialen Dynamiken zu entwickeln, die zur Entstehung der Verhaltensauffälligkeiten beigetragen haben.
GRENZEN DER PSYCHOANALYSE BEI DER ARBEIT MIT KINDERN
Trotz ihrer Vorteile stößt die Psychoanalyse bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch an ihre Grenzen. Gerade bei schweren, akuten Verhaltensstörungen oder Selbstgefährdung kann eine rein psychoanalytische Behandlung nicht ausreichen. Hier sind oft kombinierte Ansätze aus verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen (Psychodynamische Therapie, Verhaltenstherapie sowie systemische Therapie) und medikamentöser Behandlung sinnvoll. Die Psychoanalyse erfordert zudem viel Zeit und ein hohes Maß an Geduld, was bei der Arbeit mit ungeduldigen oder stark belasteten Jugendlichen häufig nicht gegeben ist.
Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Psychoanalyse oft als elitäre Wissenschaft bzw. Therapiemethode und wenig zugänglich wahrgenommen wird. Sie erfordert nicht nur einen erfahrenen Therapeuten, sondern auch eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst durch das behandelte Kind oder den Jugendlichen, was in bestimmten Lebensphasen aufgrund der fehlenden bzw. noch nicht ausgebildeten Reflexionsfähigkeiten oder auch aufgrund neurobiologischer Veränderungen (z. B. Pubertät) schwer umzusetzen ist.
FAZIT: KANN PSYCHOANALYSE VER-HALTENSAUFFÄLLIGEN KINDERN UND JUGENDLICHEN HELFEN?
Ein psychoanalytisches Vorgehen kann bei Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen durchaus sinnvoll sein, wenn tiefer liegende emotionale oder familiäre Konflikte im Vordergrund stehen. Allerdings sollte die Behandlung stets an die individuellen Bedürfnisse des Kindes oder Jugendlichen angepasst werden. In vielen Fällen kann eine integrative Therapie, die psychoanalytische Ansätze mit verhaltensorientierten oder systemischen Verfahren kombiniert, effektiver sein.
Kurz gesagt: Ein psychoanalytisches Vorgehen passt grundsätzlich zu Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, aber es sollte stets im Kontext einer ganzheitlichen Behandlungsstrategie angewendet werden.

Dr. phil. Alexander Prölß Heilpraktiker für Psychotherapie, Staatlicher Schulpsychologe, Beratungsrektor für Psychologie, Supervisor und Notfallpsychologe