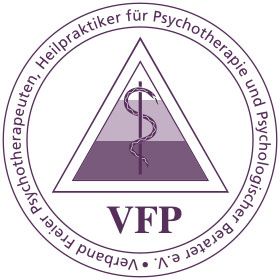Wie Farben sich mit Gefühlen verbinden
KUNSTTHERAPIE TRIFFT PSYCHODYNAMIK
In der therapeutischen Arbeit mit Klienten erleben wir oft, dass Worte an Grenzen stoßen. Manche Erlebnisse sind so tief im Inneren verankert, dass sie sich nicht in Sprache fassen lassen. Es sind genau diese Momente, in denen kreative Methoden wie die Kunsttherapie Türen öffnen nicht nur zu Emotionen, sondern auch zu unbewussten inneren Prozessen.
Besonders in Verbindung mit einem psychodynamischen Verständnis entfaltet die Kunsttherapie ihr tiefenwirksames Potenzial: Sie wird zu einem Dialog zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen dem, was bewusst erinnert wird, und dem, was im Unbewussten weiterwirkt.
KUNSTTHERAPIE IST MEHR ALS NUR KREATIVES TUN
Kunsttherapie wird in der Öffentlichkeit noch immer häufig missverstanden als eine rein gestalterische Methode, bei der das kreative Ergebnis im Vordergrund steht. In der professionellen Praxis jedoch dient das künstlerische Schaffen nicht in erster Linie der ästhetischen Gestaltung, sondern als Spiegel innerer Zustände, als Projektionsfläche für emotionale Konflikte und als nonverbaler Ausdruck von psychischen Dynamiken.
Die Stärke dieser Methode liegt darin, dass keinerlei künstlerische Vorkenntnisse notwendig sind. Vielmehr geht es um das Erleben, das Spüren und das bewusste Einlassen auf alle möglichen Farben, Formen sowie Materialien.
Durch den Prozess des Gestaltens wird das implizite Wissen all dessen, was nicht in Worte gefasst werden kann, in eine sicht- und fühlbare Form gebracht. Die entstehenden Werke können dabei flüchtig,
Es geht um Erleben, Spüren und das bewusste Einlassen auf Farben, Formen und Materialien.
roh und unperfekt sein. Gerade darin liegt oft ihre besondere Authentizität.
PSYCHODYNAMISCHE PERSPEKTIVE
Der psychodynamische Ansatz versteht Symptome, Verhalten und Beziehungsmuster als Ausdruck unbewusster Konflikte, Abwehrmechanismen und früher Beziehungserfahrungen. Zentral ist hier das innere Erleben: Wie gestaltet ein Mensch die Beziehung zu

sich selbst, zu anderen und zur Welt? Welche ungelösten Konflikte wirken im Hier und Jetzt fort, oft unbemerkt, aber mit spürbarer Wirkung?
In der psychodynamischen Arbeit wird davon ausgegangen, dass ein Teil der psychischen Realität unbewusst bleibt. Diese unbewussten Anteile beeinflussen nicht nur das Denken und Handeln, sondern auch die Art, wie wir Emotionen erleben und ausdrücken. Durch die Einbeziehung der Kunsttherapie wird dieser Ansatz um eine weitere Dimension erweitert: Was sich sprachlich nicht ausdrücken lässt, kann sich in Bildern, Farbverläufen, Linien und Symbolen zeigen, oft überraschend, manchmal verstörend, aber fast immer bedeutsam. Das Werk fungiert hier als Mittler zwischen dem bewussten Ich und den unbewussten inneren Anteilen.
Was sich sprachlich nicht ausdrücken lässt, kann sich in Bildern zeigen.
Die Farbe wird zur Brücke zwischen Gefühl und Bewusst- sein.
FARBEN ALS EMOTIONALE TRÄGER
In der Kunsttherapie sind Farben mehr als nur Gestaltungselemente. Sie sind emotionale Träger, Symbolträger und manchmal sogar Erinnerungsanker. Eine Fläche in tiefem Blau kann beruhigend wirken, Sehnsucht wecken oder Melancholie auslösen. Ein kräftiges Rot wird häufig mit Wut, Energie oder Leidenschaft assoziiert. Doch diese Bedeutungen sind individuell geprägt. Was für eine Person Geborgenheit bedeutet, kann bei einer anderen Angst hervorrufen, abhängig von persönlichen Erfahrungen, kulturellem Kontext und innerer Verfassung. In der therapeutischen Beziehung steht daher nicht die objektive Deutung im Vordergrund, sondern die subjektive Bedeutung: „Was löst dieses Bild in Ihnen aus?“ Eine scheinbar einfache Frage, die intensive innere Prozesse anstoßen kann. Die Farbe wird so zur Brücke zwischen Gefühl und Bewusstsein.
DAS BILD ALS BÜHNE INNERER KONFLIKTE
Aus psychodynamischer Sicht kann das entstehende Bild als Bühne innerer Szenen verstanden werden, ähnlich wie ein Traum, in dem Konflikte, Beziehungswünsche oder Abwehrmechanismen verdichtet erscheinen. Hierbei geht es nicht darum, das Bild im Sinne einer eindeutigen Symbolsprache zu interpretieren, sondern im Dialog mit dem Klienten zu erkunden, welche persönlichen Bedeutungen darin enthalten sind.
Durch diesen gemeinsamen Prozess entstehen oft neue Sichtweisen, emotionale Durchbrüche und tiefere Einsichten in die eigene innere Welt. Manche Bilder werden zu Meilensteinen in der Therapie. Sie markieren Momente, in denen etwas bisher Unsichtbares Gestalt angenommen hat.
DIE ROLLE DES THERAPEUTEN
Der Therapeut begleitet diesen Prozess mit einer Haltgebenden, wertschätzenden Haltung. Es geht nicht darum, das Bild „richtig“ zu verstehen, sondern einen geschützten Raum zu schaffen, in dem sich innere Prozesse entfalten dürfen. Dabei kommen auch in der künstlerischen Begegnung die für die psychodynamische Arbeit typischen Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene ins Spiel, manchmal subtil, manchmal sehr deutlich. Die Art, wie Klienten Materialien wählen, mit Kritik umgehen oder den Prozess abbrechen, kann wertvolle Hinweise auf Beziehungserfahrungen und innere Dynamiken liefern.
FALLSTUDIE: WUT IN ROT
Eine Klientin, die sich selbst als „immer angepasst“ beschreibt, beginnt in einer Sitzung plötzlich, mit kräftigen roten Strichen auf das Papier zu schlagen. Das entstehende Bild ist voller Spannung und Unruhe. Im anschließenden Gespräch sagt sie: „Ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren ist.“ Hier zeigt sich ein klassischer Moment, in dem der kreative Prozess Zugang zu einem bislang unbewussten Affekt verschafft, in diesem Fall unterdrückte Wut. Im psychodynamischen Verständnis kann dieser Affekt nun bewusst wahrgenommen, in die therapeutische Beziehung eingebracht und weiterbearbeitet werden.
FORSCHUNG UND WIRKSAMKEIT
Studien belegen, dass kunsttherapeutische Interventionen emotionale Ausdrucksfähigkeit fördern, Stress reduzieren und Selbstreflexion vertiefen können. In der Verbindung mit psychodynamischen Ansätzen zeigt sich eine besondere Stärke: Das bildnerische Arbeiten aktiviert emotionale Gedächtnisinhalte und ermöglicht so eine direkte Bearbeitung unbewusster Themen, ohne dass sie zunächst vollständig in Sprache gefasst werden müssen.
Für Heilpraktiker für Psychotherapie und psychologische Berater bietet diese Kombination einen ressourcenorientierten Zugang, der sowohl stabilisierend als auch tiefenwirksam sein kann.
FAZIT: INTEGRATION SCHAFFT TIEFE
Die Verbindung von Kunsttherapie und psychodynamischem Verständnis bietet eine tiefenpsychologisch fundierte, kreative Herangehensweise für die psychotherapeutische Praxis. Sie ermöglicht es, auch ohne Worte in innere Prozesse einzutauchen, unbewusste Konflikte sichtbar zu machen und emotionale Blockaden zu lösen.
Wenn Farben sich mit Gefühlen verbinden, entsteht ein Raum, in dem Heilung nicht nur durch Verstehen, sondern auch durch Erleben, Spüren und kreativen Ausdruck geschieht.
AUSBLICK
Ab Herbst 2026 werde ich gemeinsam mit meiner geschätzten Kollegin Andrea Broichheuser an der Paracelsus Gesundheitsakademie Köln Kunsttherapie unterrichten. Unser Unterricht wird ganzheitlich ausgerichtet sein und sowohl psychodynamische als auch anthroposophische Ansätze einbeziehen. Dabei verstehen wir den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist und betrachten künstlerisches Gestalten nicht nur als therapeutisches Werkzeug, sondern auch als Weg zu Selbstentwicklung und innerer Balance.
Unser Ziel ist es, angehenden Therapeuten praxisnahe Methoden zu vermitteln, die Kreativität, Selbstreflexion und tiefenpsychologische Einsicht gleichermaßen fördern und dabei Raum für spirituell-seelische Dimensionen des Heilungsprozesses lassen.
Wie gestaltet ein Mensch die Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zur Welt?
Ralf Prickartz
Psychologischer Berater mit Praxis in Köln, Dozent der Paracelsus Gesundheitsakademien