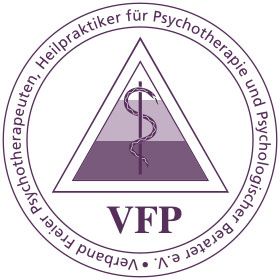Therapien bei Rassismus- und Diskriminierungs- Erfahrungen
THERAPIEN BEI RASSISMUS- UND DISKRIMINIERUNGS- ERFAHRUNGEN
Rassismus ist kein einfaches Thema, da es sehr unterschiedliche Erfahrungen sind, die Betroffene erleben, je nach ihrer Herkunft und dem Kontext, in dem die rassistische Diskriminierung stattfindet.
Bei Rassismus geht es immer um Machtverhältnisse. Eine Gruppe sieht sich selbst wertiger als die andere Gruppe, die sie bewusst herabsetzt, um sich aufzuwerten.
„Und ein wesentlicher Mechanismus ist hier das Othering: Eine privilegierte Gruppe definiert, wer dazugehört und wer nicht und was die Spielregeln sind. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, berichten häufig, anders behandelt zu werden, sich selbst anders zu erleben, nicht dazuzugehören, benachteiligt zu sein oder aufgrund von kulturell oder körperlich zugeschriebener Merkmale nicht dieselben Rechte oder Möglichkeiten zu haben“ (Erhardt, 2021). Dadurch fühlen sich Personen, die rassistische Erfahrungen gemacht haben, ausgeschlossen und ausgegrenzt.
Das Gefühl, nicht dazuzugehören, verunsichert und kränkt diese Personen. „Als Menschen kommen wir mit einer Urverbindung auf die Welt, die uns sagt: Hier gehören wir hin. Menschen, die Rassismus erfahren, bekommen oft schon früh signalisiert: Auf keinen Fall gehörst du dazu. Das ist eine Fremdbestimmung, die gravierende Schädigungen in der Seele zur Folge hat“ (Dahmer, 2023). Die rassistisch angegangene Person wird anders definiert, als ihre Persönlichkeit ist, dadurch verliert sie ihr Selbstbild, denn sie besteht nur noch aus ihren Herkunftsmerkmalen und den damit verbundenen Vorurteilen. Um dazuzugehören, versuchen einige betroffene Personen der Mehrheitsgesellschaft immer mehr zu gleichen und verlieren dadurch aber immer mehr ihr Selbstbild. „Rassismus wird von der Gesellschaft getragen, obwohl wir wissen,
dass er krank macht. Meine Klienten sind nicht krank, sondern Symptomträger“ (Dahmer, 2023). Die Belastungen der Klientinnen sind somit eine gesunde Reaktion auf ein krank machendes Phänomen. Personen mit Migrationshintergrund erleben, dass sie vonseiten der Aufnahmegesellschaft, aber auch von Personen mit anderen Migrationshintergründen, wegen ihrer Herkunft diskriminiert, rassistisch behandelt und ausgegrenzt werden. Eine Personengruppe setzt andere herab, um sich selbst aufzuwerten (Klewin & Tillmann, 2006, S. 198ff. Helsper, 2006, S. 211ff.). Es ist, als ob es eine „Rassismus-Pyramide“ gibt. Und alle Personen mit den unterschiedlichen Migrationshintergründen wollen an die Spitze dieser Pyramide emporsteigen und setzen damit andere Herkunftsländer herab, damit diese dann eine Stufe niedriger in dieser Pyramide stehen. Damit fühlen sie sich von der Aufnahmegesellschaft akzeptiert und dazugehörig, haben aber dafür andere Personen herabgesetzt und ausgegrenzt, was sie wiederum auch zu Tätern macht. Auch Taten, wie 9/11 oder die Flüchtlingskrise können die Anordnung in der „Rassismus-Pyramide“ verändern und für eine Herabsetzung einer bestimmten Herkunft sorgen. Dies hat sehr negative Folgen auf das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept (Amrhein, 2022).
Gerade bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Angst- oder Panikstörungen ist das Einbeziehen von rassistischen Erfahrungen, rechtsradikalen Erfahrungen, Ausgrenzung, Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing oder Herabsetzung in der Therapie essenziell wichtig. Leider gibt es in der Fachliteratur und auch in der Ausbildung kaum spezielle Ausrichtungen zu der Frage, wie Rassismus-Erfahrungen die psychische Entwicklung und somit auch die Identitätsentwicklung, die Entwicklung des Selbstkonzepts und auch des Attributionskonzepts sowie die Resilienz beeinflussen können (Erhardt, 2021; Amrhein, 2022; Oerter & Montada, 2008, S. 865f.). Werden die Patienten nur als verängstigte oder sensible Personen abgetan, dann wird dies ihrer erlebten Biografie nicht gerecht. Denn dies wären dann keine sensiblen Persönlichkeitsstörungen, sondern posttraumatische Belastungsstörungen, die es anzugehen und zu verarbeiten gilt – was eine ganz andere Art der Gespräche, Behandlung und Therapie nach sich ziehen würde (Dahmer, 2023; Erhard, 2021). Wichtig ist, das Erlebte anzunehmen und einen gesunden
Rassismus wird von der Gesellschaft getragen, obwohl wir wissen, dass er krank macht.
Umgang mit dem Geschehenen zu finden, um damit leben zu können. Dabei muss das Selbstwertgefühl gesteigert werden, um ein starkes Selbstkonzept aufzubauen und Selbstregulierungsmechanismen zu erarbeiten, die dabei helfen, die Resilienz stärker auszubauen. Während der Therapie kann parallel auch an dem Attributionskonzept gearbeitet werden. Hierfür bieten sich von Sport über kreatives Schreiben oder Malen, Musik machen, etwas in der Natur gestalten vielfältige Möglichkeiten an.
Wichtig ist nicht nur, die Aktivität auszuüben und dann ist die Übungsstunde vorbei, sondern in dieser Zeit sollte den Klienten auch inhaltlich die Möglichkeit der Annäherung an die neue Kultur genau erläutert werden. Dabei können Veränderungen und Erfolge festgehalten und lobend erwähnt und aufgezeigt werden, damit Klienten lernen, die positive Entwicklung selbst wahrzunehmen, realistisch einzuschätzen und auch bei Rückschlägen damit umgehen zu können. Die Klienten sollten dies nach Therapieende zu Hause eigenständig weiterführen können und dafür das ganze Know-how vermittelt bekommen. Hilfreich ist, ihnen einen Ordner mitzugeben, der die ganzen Inhalte speziell für diesen Klienten mit den einzelnen Schritten der Therapie, die Erfolge, aber auch die Rückschläge und die dazu erlernten Selbstregulierungsmechanismen enthält. Zudem sollte gezielt aufgezeigt werden, wie die Klienten die Arbeit
an ihrer Persönlichkeit weiter zu Hause angehen können und welche Aufgaben und Übungen speziell für sie gut sind, was es in ihrem Alltag zu beachten gibt und welche Lösungsstrategien speziell für sie hilfreich sind, um mit problematischen Situationen umgehen zu können.
PERSPEKTIVEN BEI DEN THEMEN EIN-WANDERUNGSLAND UND RASSISMUS
Leonore Lerch, Vorsitzende des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie, forscht zu „Psychotherapie im Kontext von Machtungleichheiten und Intersektionalität“ (Erhardt, 2021). Unsere Gesellschaft hat noch nicht gelernt, über das Thema Rassismus zu sprechen. Auch in der psychotherapeutischen Praxis und Ausbildung wird dies nicht berücksichtigt. „Und da ist die Psychotherapie quasi ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn wir Rassismus als gesellschaftliches System sehen, dann sind wir ja alle von Rassismus betroffen – nur in unterschiedlicher Weise. Und ich denke, da ist dann nicht die Frage, ob eine einzelne Person das jetzt will oder nicht will, sondern es geht tatsächlich darum, anzuerkennen: Rassismus findet statt, ob wir das wollen oder nicht“ (Erhardt, 2021). In den USA wird Rassismus als Traumatisierung anerkannt, so spricht man dort von „Race Based Traumatic Stress“. Jedoch haben Deutschland und Österreich Probleme damit, anzuerkennen, dass sie Einwanderungsländer sind. „Deutschland tut sich sehr schwer, auf den eigenen, sehr verwurzelten und stark institutionalisierten Rassismus zu schauen. Nach wie vor gibt es die Tendenz, uns Deutschland nicht als Heimat zuzugestehen“ (Dahmer, 2023).
In unserer Gesellschaft wird Rassismus eher geleugnet und wenn, dann nur mit der Migration diskutiert. Dadurch gelangt das Thema nicht in die breite Öffentlichkeit. „Es ist auch immer eine Machtfrage: Es sind meist weiß positionierte Menschen, die in der Regel die Inhalte bestimmen. Weiß positionierte Menschen müssten hinterfragen, welche Rolle sie im System von Rassismus spielen: Welche Privilegien und Vorteile haben sie aufgrund von Rassismus und wie profitieren sie davon? Diese Auseinandersetzung, die ja auch unter dem Stichwort Critical Whiteness bekannt ist, ist natürlich eine, die, wenn sie ehrlich geführt wird, zu Verunsicherung führt und unter Umständen eben auch bedeutet, Privilegien aufzugeben. Und das ist kein Thema, wo jetzt alle sagen: „Ja, das wollen wir unbedingt.“ (Erhardt, 2021).
FORSCHUNGSSTAND DER AUSBILDUNG UND DER AUSBAU DER BEHANDLUNGS-ANGEBOTE
Rassismus wird kaum in der Psychotherapieausbildung angesprochen, genauso fehlen weitere Ausbildungsangebote zu diesem Thema und die Forschung weist sehr wenig dazu auf, wie sich Rassismuserfahrungen auf die psychische und körperliche Gesundheit auswirken (Amrhein, 2022). „Die Diagnose ‚Zielscheibe feindlicher Diskriminierung und Verfolgung‘ (Z60.5) in der ICD-10 bietet eine Möglichkeit, psychische Belastungen durch Diskriminierung zu codieren und als Belastungsfaktor sichtbar zu machen“ (Amrhein, 2022).
Themen wie Rassismus und Diskriminierung sollten in das Psychologie-, Medizin- und Pädagogikstudium eingebaut werden und in die Psychotherapie- und Facharztausbildung miteinfließen (Amrhein, 2022; Dahmer, 2023). „Dazu gehört zum einen diskriminierungs- und rassismus-sensibles Denken, das als lebenslanger Lern- und Auseinandersetzungsprozess verstanden werden kann. Zum anderen sollte der Umgang mit Patienten mit Rassismuserfahrungen fester Bestandteil der Psychotherapie-Ausbildung sein“ (Amrhein, 2022). „So hat sich der Verbund ‚Rassismuskritische Psychotherapie und Beratung‘ zum Ziel gesetzt, Psychotherapeuten und Berater für eine rassismuskritische Arbeit auszubilden. Auch die
Rassismus findet statt, ob wir das wollen oder nicht!
Seite DE_Construct des Portals My Urbanology bietet Weiterbildungsangebote zum Thema rassismussensible Therapie und Beratung für Mitarbeitende im psychosozialen Bereich an, etwa für Psychotherapeuten und Berater“ (Amrhein, 2022).
Einige Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund möchten gerne ihre Behandlung bei Therapeuten belegen, die sich mit dem Thema Rassismus auskennen und eine rassismus-sensible Psychotherapie anbieten. Zudem wollen einige Klienten Therapeuten, die auch einen Migrationshintergrund aufweisen oder eine andere Hautfarbe besitzen (Amrhein, 2022). „Organisationen wie My Urbanology, Black in Medicine oder Each One Teach One können bei der Suche nach Psychotherapeuten helfen, die rassismussensible Psychotherapie anbieten oder auf die Arbeit mit Menschen mit anderer Hautfarbe spezialisiert sind. Auch Beratungsstellen für Migranten, Frauenberatungsstellen, andere soziale Beratungsstellen oder die Telefonseelsorge können möglicherweise bei einer gezielten Suche helfen“ (Amrhein, 2022). Bei der Auswahl der Therapeuten sollten die Klienten genau fragen, ob sich diese mit Rassismus und den Therapieformen auskennen.
Welche Qualifikationen sollte das Personal aufweisen, das Therapien für Personen mit Migrations- und Fluchthintergrund anbietet?
Therapeuten sind mit der Behandlung von Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund überfordert, weil ihnen das Wissen über den kulturellen Hintergrund fehlt (Corves, 2009). Die Personen mit Fluchtoder Migrationshintergrund wollen sich akzeptiert und anerkannt fühlen. Im Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie und Supervision der Charité (ZIPP) arbeiten Psychologen, Sozialarbeiter und Ethnologen, die meisten von ihnen weisen selbst einen Migrationshintergrund auf (Corves, 2009). Das Personal im ZIPP vergegenwärtigt sich seiner eigenen kulturellen Prägung und versucht, die der Betroffenen zu verstehen.
Seit 2002 wurden über 600 Patienten aus 90 Ländern behandelt. Die Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund sprechen untereinander über das vorhandene Angebot und so suchen immer mehr Patienten das ZIPP auf. Personen mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben eine niedrigere Hemmschwelle, das ZIPP aufzusuchen. Sie besitzen eher die Hoffnung, Personal vorzufinden, das sie versteht. Außerhalb des ZIPP sind Psychologische Anlaufstellen nicht so „interdisziplinär und interkulturell“ ausgestattet und somit überfordert, wenn ein Betroffener eine Behandlung benötigt (Corves, 2009). „Erstmal werden die Therapeuten ein bisschen hilflos und es steckt auch eine bestimmte Spannung darin, dass professionelle Menschen hilflos werden – zu hilflosen Helfern. Und dann neigt man natürlich zu Stereotypen.“ (Corves, 2009).
Es ist eine Diskussion über die Zulassungskriterien von Psychotherapeuten entstanden. Dabei wird debattiert, ob es sinnvoll wäre, muttersprachliche Angebote auszurichten und Personen mit Migrationshintergrund einzustellen. Allerdings kann dies kein Zulassungskriterium sein, denn dies wäre eine positive ethische Diskriminierung (Seeling, 2012; Amrhein, 2022). Manche Personen mit Migrationshintergrund wollen bei bestimmten Themen gar nicht zu Personen aus ihrer Herkunftskultur, weil sie da eher blockiert sind, mit ihnen darüber zu sprechen, auch dies müsste je nach Thema und Sprachkenntnissen berücksichtigt werden (Seeling, 2012). Personen mit Migrationshintergrund einzustellen und muttersprachliche Therapieangebote helfen bestimmt, Barrieren und Missverständnisse abzubauen, aber dies alleine ist nicht die Lösung, denn es geht um viel mehr.
Es werden andere Testdiagnostiken und -auswertungen benötigt. Das gesamte Personal sollte verpflichtende Weiterbildungen zu flucht- und migrationsspezifischen Themen erhalten, wie die Akkulturationseinstellungen, aber auch zu Rassismus und Rechtsradikalismus und die Auswirkungen auf die Seele, die Persönlichkeitsstrukturen, das Verhalten, die Identität, das Selbstkonzept, das Attributionskonzept, die eigene Biografie, Beziehungen und der Umgang mit Konflikten sollte dementsprechend geschult werden. Denn alle diese Faktoren beeinflussen sich wechselseitig. Nicht immer liegen tatsächlich Erkrankungen vor, sondern aufgrund von Belastungen bestehen eher posttraumatische Störungen, die durch Gesprächstherapien und weitere Angebote gut therapiert werden könnten, sodass ein sehr gutes Leben in der Aufnahmegesellschaft gelingen kann, wenn diese es durch ihre eigenen Akkulturationseinstellungen zulassen (Oerter & Montada).
Auch die Akkulturationseinstellung der Gesellschaft, in welche die Person mit Flucht- oder Migrationshintergrund sich integrieren möchte, spielt eine entscheidende Rolle. Ist dies überhaupt möglich oder wird vonseiten der Aufnahmegesellschaft jegliche Partizipations- und Integrationsbemühung verhindert
und fehlen schlicht Kontaktangebote. Oder grenzt sich die geflüchtete oder migrierte Person komplett von der Aufnahmegesellschaft ab, obwohl diese Gesellschaft der Integration offen und willkommend entgegentritt. Es wird gefordert, dass Psychotherapeuten, psychiatrisch und psychosomatisch tätige Ärzte interkulturelle oder transkulturelle Kompetenzen aufweisen. „Laut der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) sollten interkulturelle Kompetenzen fester Bestandteil der Ausbildung zum psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten sowie von Fort- und Weiterbildungen und Supervisionen sein“ (Amrhein, 2022).
Die interkulturellen und transkulturellen Kompetenzen in der Psychotherapie bieten eine große Chance, neue Ansätze und Methoden zu konstruieren und die Psychotherapie somit weiter auszubauen (Amrhein, 2022). Allerdings werden bislang interkulturelle Inhalte sehr untergeordnet in der Ausbildung in den Musterbildungsordnungen zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und zum Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie von 2018 erwähnt. „In Deutschland gibt es bisher keine etablierte, auf festen Standards beruhende interkulturelle Psychotherapie“ (Amrhein, 2022).
Bei der transkulturellen Kompetenz haben die Personen ein Bewusstsein über ihre eigene Kultur, verfügen über Wissen anderer Kulturen und besitzen noch die Fähigkeit, mit Personen aus anderen Kulturen umzugehen (Philipps-Universität Marburg). In der Psychologie und Psychiatrie gibt es keine spezielle Ausbildung, kaum Fachliteratur oder Therapieangebote, die sich an den kulturellen und religiösen Einstellungen der Personen mit Flucht- und Migrationshintergrund orientieren (dgppn; Amrhein, 2002; Seeling, 2012). „Um eine hohe Qualität von Trainingsund Ausbildungsinhalten für interkulturelle Kompetenz zu gewährleisten, haben Arbeitsgruppen an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Leitlinien für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Psychotherapeuten in interkultureller Kompetenz entwickelt“ (Amrhein, 2022).
Bei einer interkulturellen Psychotherapie ist es eine Grundvoraussetzung, Personen aus anderen Kulturen eine offene, neugierige, interessierte, respektvolle und wertschätzende Einstellung gegenüber zu besitzen. Dabei sollten die Therapeuten versuchen, sich einfühlsam in die verschiedenen kulturellen Denkweisen und Gefühle der Klienten einzudenken, diese nachzuvollziehen, zu verstehen und einordnen zu können. „Dabei sollten sie auch Einstellungen, Wertvorstellungen und Meinungen aushalten können, die von ihren eigenen abweichen“ (Amrhein, 2022). Die Therapeuten sollten auch in der Lage sein, bei sich selbst ein Gefühl von Fremdsein, Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten, Unsicherheit, Unwissen und die eigene kulturelle Eingebundenheit wahrzunehmen, anzunehmen, zu hinterfragen und daran bei sich selbst zu arbeiten. Dies setzt eine Stresstoleranz und Flexibilität voraus. Von Beginn an sollten Therapeuten eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, indem sie den Klienten zeigen, dass sie ihnen zuhören, sie wahrnehmen und sie ernst nehmen. Bei einer vertrauensvollen Beziehung können sich Klienten mehr öffnen und eher über ihre Themen sprechen, weshalb sie in der Therapie sind (vgl. Amrhein, 2022). Die Therapeuten sollten erläutern, dass ihre Nachfragen dazu dienen, die Klienten mit ihren kulturellen Hintergründen, Einstellungen, Werten und Normen besser zu verstehen. Wichtig dabei ist eine einfühlsame Grundhaltung. Im Vordergrund der Therapie stehen die Ziele und Bedürfnisse der Klienten. „Um Schwierigkeiten in der therapeutischen Beziehung zu lösen, ist es wichtig, Übertragung und Gegenübertragung in der Therapie bewusst zu beobachten und zu bearbeiten“ (Amrhein, 2022).
In Deutschland gibt es bisher keine etablierte, auf festen Standards beruhende interkulturelle Psychotherapie.
Wichtig ist, ein multimodales Behandlungskonzept aufzubauen, das aus Psychotherapeuten, sozialarbeiterischer und medizinischer Versorgung besteht sowie eine aufenthaltsrechtliche Beratung aufweist. Die Psychotherapeutinnen sollten aus einem interkulturellen Team bestehen, das den jeweiligen Kulturkreis der Klienten gut kennt. Regelmäßige Teambesprechungen und Supervisionen können helfen, dass sich die Mitarbeitenden stetig über typische Problemstellungen in der Arbeit mit Migranten austauschen. Eine ständige Weiterbildung zu ihrem interkulturellen Wissen und ihren Kompetenzen ist für die Therapeuten notwendig. Dabei sollten sie ihr Wissen über andere Kulturen, Normen, Werte, Traditionen, Familienstrukturen, kulturspezifische Umgangsformen erweitern. Dieses Wissen sollten die Therapeuten in ihren Behandlungsgesprächen anwenden und sich selbst reflektieren, ob sie die Umgangsformen ihres Gegenübers respektieren und erwidern, z.B. zum Verständnis füreinander, bei der Frage der Geduld, Höflichkeit und des Respekts füreinander. „In der Therapie kann eine bewusste Haltung des Nicht-Wissens hilfreich sein: Therapeuten sollten sich bewusst machen, dass sie vieles aus der Kultur ihrer Patienten nicht kennen. Dabei sollten sie auch berücksichtigen, dass die Vorstellungen zur Entstehung und Behandlung psychischer Erkrankungen weltweit sehr unterschiedlich sein können“ (Amrhein, 2022).
Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Selbsterfahrung und Selbstreflexion bei interkulturellen Begegnungen. Ein weiterer Aspekt ist die bewusste Auseinandersetzung der Therapeuten mit eigenen Unsicherheiten oder negativen Gefühlen, die eigenen Toleranzgrenzen zu erforschen und zu sehen, wie sie selbst auf Unklarheiten oder Mehrdeutigkeiten reagieren, wenn sie mit Klienten mit Flucht- oder Migrationshintergrund arbeiten. „Bei der Selbsterfahrung soll es laut Leitlinien darum gehen, sich die eigene kulturelle Prägung, eigene Normen und Werte, eigene Vorurteile und Stereotypen und mögliche Abwehrmechanismen gegenüber Fremdem und anderen Kulturen bewusst zu machen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen“ (Amrhein, 2022).
KOMMT ES AUCH WÄHREND DER THERAPIE ZU RASSISTISCHEN ODER DISKRIMINIERENDEN ERFAHRUNGEN?
Klienten, die aufgrund von rassistischen Erfahrungen eine Psychotherapie aufsuchen, leiden unter Ängsten, insbesondere Versagensängsten, fühlen sich niedergeschlagen, leiden unter Belastungen ihres Selbstwertgefühls. Auch der Körper leidet unter diesen rassistischen Belastungen, sodass es zu psychosomatischen Erkrankungen wie Schlafstörungen, Kopf- und Magenschmerzen kommen kann. Diese Krankheitssymptome müssen genau angesehen und im Kontext der rassistischen Erfahrungen betrachtet werden (Erhardt, 2021). Während einer psychologischen Therapie kann es auch zu Rassismus- oder Diskriminierungsfällen kommen. Dies wird allerdings kaum thematisiert. Dabei wäre dies sehr wichtig, weil diese Erfahrungen weitere psychische Belastungen entstehen lassen oder bestehende noch verschlechtern.
Einige Therapeuten gehen aus ihrer Sicht davon aus, dass alle Menschen gleich sind und Rassismus, Herkunft oder Hautfarbe in der Therapie nicht relevant sind. Dies kann dazu führen, dass Klienten das Thema Rassismus nicht ansprechen oder Therapeuten die Erlebnisse verharmlosen und die Klienten sich dadurch nicht ernst genommen fühlen. Andere Therapeuten stellen die Herkunftskultur oder die Hautfarbe so sehr in den Vordergrund, dass es diskriminierend erlebt werden kann. Manche Therapeuten diskriminieren Klienten sogar selbst aufgrund der Herkunft unbewusst. „Manche Psychotherapeuten haben stereotype Annahmen und Vorurteile gegenüber Menschen aus anderen Kulturen und behandeln sie bewusst abwertend oder benachteiligend. In diesem Fall sollten Patienten sich umgehend Unterstützung und einen anderen Therapeuten suchen. Zum Beispiel können sie sich an eine Beratungsstelle für solche Fälle wenden oder eine Beschwerde bei der Psychotherapeutenkammer ihres Bundeslandes einreichen“ (Amrhein, 2022).
Aber auch vom Klienten kann es zu rassistischem Verhalten gegenüber Therapeuten kommen. „Aber wenn wir von Rassismus als System sprechen, dann bedeutet das, dass Rassismus Menschen unterdrückt und krank macht. Und wenn wir dann unsere Bemühungen nicht dahin richten, dieses System zu verändern, sondern die Menschen pathologisieren, die unter dem System leiden und das System eigentlich beibehalten – dann ist das natürlich ein berechtigter Vorwurf, auch an die Psychotherapie: Also inwieweit die Psychotherapie Menschen wieder repariert, aber das System sich nicht ändert“ (Erhardt, 2021).
Der weitere Teil des Artikels folgt in Kürze..