Die Polyvagal-Theorie: Auswirkungen auf die therapeutische und beraterische Arbeit
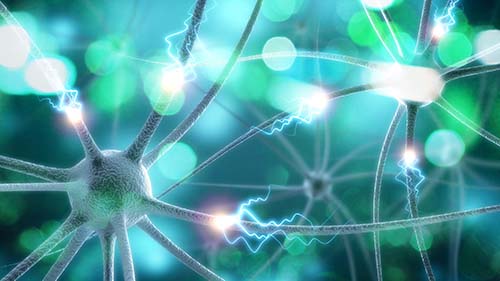
Nachdem im ersten Beitrag die Grundlagen der Polyvagal-Theorie erläutert wurden, geht es in diesem Artikel darum, welche Auswirkungen die Erkenntnisse der Polyvagal-Theorie auf die therapeutische sowie die beraterische Arbeit haben und wie Therapeuten (immer m/w/d) dieses Wissen in ihre eigene Tätigkeit einbringen können.
Die Regulation des Nervensystems muss erlernt werden
Sowohl die Fähigkeit zur Regulation unseres Nervensystems als auch die zur sozialen Interaktion sind nicht angeboren. Säuglinge bzw. Kleinkinder müssen dies in den ersten Lebensmonaten und -jahren erst erlernen. Dieses geschieht durch Nachahmung der Bezugspersonen, meist der Mutter.
Bei Säugetieren ist die neuronale Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems (ANS) eng mit der neuronalen Regelung der für das Hören und Sprechen zuständigen Muskulatur gekoppelt (Mittelohr, Rachen, Kehlkopf). Diese sind auch maßgeblich für die Aktivitäten des Social-Engagement-Systems (SES).
Die Regulation, also Beruhigung oder Stimulation des Neugeborenen, geschieht durch eingestimmte Kommunikation und Einfühlen in das Kind. Die Mutter reguliert quasi das Nervensystem des Kindes mit ihrem eigenen Nervensystem. Sehr anschaulich ist dieser Mechanismus dargestellt im YouTube-Video „Still–Face-Experiment“ des Forschers Edward Tronick.
Die Regulation eines anderen Menschen durch das eigene Nervensystem nennt man Co-Regulation. Wie genau diese Co-Regulation geschieht, ist noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt. Es deutet jedoch vieles darauf hin, dass bestimmte Hirnzellen, die sog. Spiegelneurone, eine wichtige Rolle dabei spielen. Spiegelneurone sind u. a. dafür verantwortlich, dass wir, wenn wir auf unser Gegenüber eingestimmt sind, dessen Gefühle wahrnehmen können.
Die grundlegende Entwicklung des Nervensystems dauert bis in das vierte Lebensjahr an. Kommt es in dieser Phase zu potenziell traumatischen Erfahrungen, wie länger andauernde Trennung von den Bezugspersonen oder emotionale Vernachlässigung, kann das SES in seiner Entwicklung nachhaltig gestört werden. Man spricht dann von einem Entwicklungs- oder Bindungstrauma, im Gegensatz zum Schocktrauma, das durch ein einzelnes, überwältigendes Erlebnis ausgelöst wird.
Ein Gefühl von Sicherheit ist entscheidend
Nur wenn wir – oder genauer gesagt: unser Nervensystem – sich sicher genug fühlt, können wir in soziale Interaktion treten. Gleichzeitig vermittelt uns soziale Interaktion ein Gefühl von Sicherheit.
Wie aber können wir unserem autonomen Nervensystem genügend Sicherheit vermitteln? Dazu gibt es grundsätzlich zwei sich ergänzende Möglichkeiten. Porges bezeichnet diese in der Polyvagal-Theorie als „passive und aktive Pfade“.
Die passiven Pfade aktivieren das System für soziale Verbundenheit ohne eigene Aktivität allein über Signale aus der Umwelt. Dies sind z. B. eine ruhige Umgebung, positive und mitfühlende Interaktionen mit anderen Menschen oder Musik im Frequenzbereich der akustischen Signale für Sicherheit, etwa durch Holzblasinstrumente oder Gesang.
Die aktiven Pfade hingegen verlangen aktives Handeln der jeweiligen Person. Sie stimulieren das ventral-vagale System z. B. über Sprechen, kontrolliertes Atmen oder bestimmte Körperhaltungen. Ob der aktive Pfad aber überhaupt zugänglich ist, setzt voraus, dass dem ANS über den passiven Pfad im Vorfeld bereits ein Mindestmaß an Sicherheit vermittelt wurde. Um Sicherheit in uns selbst erzeugen zu können, sind wir existenziell auf soziale Interaktionen – also die Unterstützung durch andere Menschen – angewiesen. Diese Unterstützung muss erstaunlicherweise nicht aktuell geschehen. Auch die Erinnerung an unterstützende Momente in der Vergangenheit kann große Wirkung zeigen. Dies erklärt die grundlegende Bedeutung der sicheren Bindungserfahrungen für das subjektive Erleben von Sicherheit.
Das Safe-and-Sound-Protocoll (SSP) – eine effektive klinische Anwendung der Polyvagal-Theorie
Die neuronale Regulationsfähigkeit des ANS ist eng mit der neuronalen Regelung der für das Hören und Sprechen zuständigen Muskulatur gekoppelt. Da lag es nahe, dieses „Portal“ therapeutisch zu nutzen. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Polyvagal-Theorie entwickelte Porges mit dem Safe-and-Sound-Protocol (SSP) eine wirksame Methode, die das ANS dabei unterstützen kann, wieder in einen entspannten Zustand zu kommen. Über speziell modulierte Musik werden dem Nervensystem Signale von Sicherheit vermittelt. Gleichzeitig wird die erstarrte Mittelohrmuskulatur gelöst und somit wieder zugänglich für akustische Regulationsmöglichkeiten. Das SSP habe ich genauer in einem eigenen Artikel beschrieben: „Mit Musik das Nervensystem entlasten“, Freie Psychotherapie, 05.22.
Auswirkungen der Polyvagal-Theorie auf therapeutisches Arbeiten
Die Erkenntnisse aus der Polyvagal-Theorie haben auch weitreichende Auswirkungen auf Vorgehen und Inhalt einer Psychotherapie. Das betrifft sowohl die Erklärungsmodelle der Entstehung psychischer Störungen und deren Diagnose als auch die Vorbereitung von Therapiesitzungen sowie das therapeutische Vorgehen in der Sitzung. In entsprechenden Fortbildungen zur Einbindung der polyvagalen Erkenntnisse in die therapeutische und beraterische Arbeit erleben die Teilnehmenden oft einen Paradigmenwechsel in Bezug auf ihre Arbeit mit Menschen.
Sicherheit ist die Therapie
Aus dem Blickwinkel der Polyvagal-Theorie ist ein neurozeptiv wahrgenommenes Gefühl der Sicherheit – sowohl aufseiten der Klienten als auch auf Therapeutenseite – die wichtigste Voraussetzung für eine gelingende Therapie. Erst wenn das autonome Nervensystem die Umgebung als sicher wertet, können therapeutische Interventionen ihre volle Wirkung entfalten.
Aus der Polyvagal-Theorie wissen wir, dass das Gefühl von Sicherheit die Domäne des ventralen Vagus ist. Möchte ich, dass meine Klienten sich sicher fühlen, muss ich also dafür sorgen, dass auch bei ihnen der ventrale Vagus aktiviert ist. Nach den Regeln der Neurozeption müssen dafür zuallererst die Therapeuten im Zustand der ventralen Vagusaktivität sein. Alles, was Therapierenden Sicherheit gibt, hilft auch den Klienten, sich sicher zu fühlen. Dann erst können weitere Schritte folgen.
Die „Chemie“ muss stimmen
Ein weiterer wichtiger Punkt ist „die Chemie“ zwischen Klienten und Therapeuten. Therapeuten müssen die Klienten mögen. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss, was die Klienten tun! Aber es muss grundsätzlich Sympathie vorhanden sein. Oder wie die Traumatherapeutin Dami Charf es ausdrückt: „Ich therapiere niemanden, mit dem ich nicht auch gerne eine Tasse Kaffee trinken gehen würde.“ Der Psychiatrieprofessor Daniel Siegel beschreibt das poetisch so: „Therapie ist eine Liebesbeziehung auf Zeit ohne sexuelle Intention“.
Eingestimmte Kommunikation
Auf dieser Haltung im Hintergrund basiert der nächste Schritt. Eine besonders wirkungsvolle Möglichkeit, Klienten ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, ist eingestimmte Kommunikation.
Diese Art der Kommunikation wird auch rechtshemisphärische Kommunikation genannt, da hierbei die Fähigkeiten der rechten Gehirnhälfte besonders gefragt sind.
Eingestimmte Kommunikation zeichnet sich durch zugewandte Aufmerksamkeit sowie annehmendes, absichtsloses, bedingungsloses Zuhören aus. Auch dies ist mehr eine Haltung denn eine Technik. Aussagen wie: „Ich bin ganz bei dir!“, „Du bist im Moment das Wichtigste!“, „Ich unterstütze dich und passe auf, dass alles sicher ist und nichts Schlimmes passiert!“ beschreiben die Grundhaltung der Therapeuten.
Hinzu kommt die verbale Kommunikation – das Sprechen. Dieses sollte möglichst mit dem ganzen Körper, mit Mimik, Augenkontakt, der Stimmlage und der Prosodie (Stimmmelodie) geschehen. Auf diese Weise hat das Nervensystem der Klienten vielfältige Optionen, Signale für Sicherheit über die visuellen und akustischen Sinneskanäle zu empfangen.
Wenn dies ausreichend gelingt, gelangen auch die Klienten mehr und mehr in einen ventral-vagalen Zustand der empfundenen Sicherheit. Mit zunehmender Einstimmung geraten die Gehirne und Nervensysteme von Therapeut und Klient in Resonanz und beginnen miteinander zu schwingen. Die Therapeuten empfinden auf diese Weise die Gefühle der Klienten. Klienten „fühlen sich gefühlt“, zutiefst verstanden.
Haben sich Therapeuten auf diese Weise in die Klienten eingeschwungen, können sie über die Regulation ihres eigenen Nervensystems die Klienten Coregulieren. Aus der Wahrnehmung einer tiefen Verbundenheit heraus können dann die Therapeuten eine geeignete Intervention auswählen und in der gleichen Verbundenheit erspüren, ob die Intervention greift oder ob sie Unsicherheit hervorruft. Eine solche Atmosphäre des Miteinanders in tiefer Verbundenheit bietet beste Voraussetzungen für eine effektive und nachhaltige Therapie.
Ziele einer Therapie
Ziel einer jeden Therapie ist es, dass die Klienten im sicheren Rahmen der Therapie die Gelegenheit erhalten, förderliche Fertigkeiten einzuüben sowie neue, heilsame Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die Menschen im Empfinden von Sicherheit gemacht haben, wirken zukünftig ebenfalls als Hinweisgeber für Sicherheit. So können sowohl passive als auch aktive Pfade zur Selbstregulation etabliert werden.
In einer polyvagal-basierten Therapie lernen die Klienten die neurologischen Hintergründe ihres Handelns und Seins verstehen. Sie erkennen, in welchem autonomen State sich ihr Nervensystem aktuell befindet, und erleben Möglichkeiten, sich selbstwirksam im ventral-vagalen State zu regulieren.
Viele namhafte Therapeuten haben inzwischen die Erkenntnisse der Polyvagal-Theorie in ihre Behandlungskonzepte eingebunden, so etwa Peter Levine, Bessel van der Kolk, Marianne Bentzen, Dami Charf, Ron Kurtz, Gunther Schmidt oder Stephen Gilligan, um nur einige zu nennen.
Und vielleicht kann ja auch dieser Artikel einen bescheidenen Beitrag zur Verbreitung dieses wertvollen Wissens zum Wohle unserer Klienten erbringen.
 Michael Krause
Michael Krause
Heilpraktiker für Psychotherapie, Dozent und Supervisor, Praxis in Bergheim/Erft
Foto: ©BillionPhoto.com | adobe stock.com

